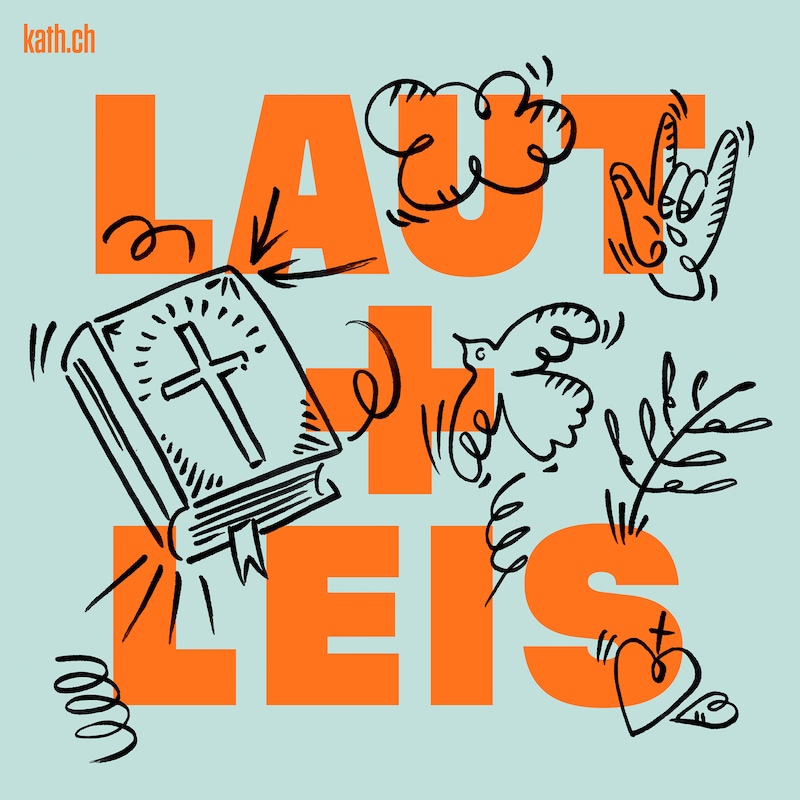
Shownotes
Die renommierte emeritierte Wirtschaftsprofessorin der Uni Zürich hat öffentlich bekannt gemacht, dass sie wieder in die Kirche eingetreten ist. Margit Osterloh spricht über die Gründe und sagt, was Unternehmen von Klöstern lernen können. Und: Sie kontert die Kapitalismus-Kritik der Päpste.
Weitere Themen dieser Folge:
- Die sogenannte «Studentinnen-Studie» hat einen Shitstorm ausgelöst: Wie ist Margit Osterloh damit umgegangen?
- Die 82-Jährige hat ein Leben lang gearbeitet und einen Sohn grossgezogen: Wie wichtig war ihr die Karriere?
- Forschung ist kein Glasperlenspiel: Wie kann sie für mehr Gerechtigkeit in der Welt sorgen?
- Die Landeskirchen sind im Sinkflug: Was könnte ihnen wieder Aufwind geben?
- In der Bibel gibt es zahlreiche Stellen, die mit Reichen hart ins Gericht gehen: Was sagt Margit Osterloh dazu?
- Die Wirtschaftsprofessorin plädiert für eine soziale Marktwirtschaft: Was versteht sie darunter?
Transcripts
Die meisten Leute sagen angeblich, wenn sie aus der Kirche austreten, sie treten deswegen aus, weil sie nicht glauben, und meine Botschaft ist, man muss nicht glauben, um in der Kirche zu sein. Die Kirche ist eine so wichtige und nützliche Institution, auch wenn man nicht an die Dinge glaubt, die üblicherweise als Glaubenskern gedacht werden.
Sandra Leis [:Das sagt Margit Osterloh, emeritierte Professorin für Betriebswirtschaftslehre der Universität Zürich. Bis heute forscht und publiziert sie regelmäßig und setzt Themen, die breit diskutiert werden. Vor zwei Jahren beispielsweise veröffentlichte sie eine Studie zu den beruflichen Ambitionen von Studentinnen. Kürzlich hat Margit Osterloh mit einem Gastbeitrag in den Tamedia-Zeitungen für Aufmerksamkeit gesorgt. Titel: «Darum bin ich wieder in die Kirche eingetreten.» Ich bin Sandra Leis und besuche Margit Osterloh für den Podcast «Laut + Leis» in ihrem Zuhause in Seefeld in Zürich. Herzlich willkommen, Margit Osterloh, zu unserem Gespräch.
Einen regelrechten Shitstorm ausgelöst hat Ihre Forschung zu den Karriereambitionen von Studentinnen der Universität Zürich und der ETH. Ergebnis dieser Studie: Frauen seien tendenziell weniger karriereorientiert als Männer. Die Empörung war riesig. Hat Sie das überrascht, damals vor zwei Jahren?
Margit Osterloh [:Ja, das hat mich sehr überrascht, weil das Ergebnis eigentlich ja nicht so furchtbar neu ist. Im Grunde hat man das schon länger gewusst, aber offensichtlich macht es einen Unterschied, ob man das dann hinschreibt und sagt oder ob das ohnehin jeder weiß.
Sandra Leis [:Hat Sie Ihr eigenes Ergebnis in dem Fall auch nicht überrascht?
Margit Osterloh [:Nein, gar nicht. Gar nicht.
Sandra Leis [:Und wieso nicht?
Margit Osterloh [:Ja, ich meine, das lehrt ja die Alltagserfahrung, dass sehr viele Frauen familienorientiert sind, und das ist ja auch gut so. Und Männer sind in der Regel weniger familienorientiert, dafür mehr berufsorientiert. Das ist halt so, und ich kann daran auch nichts Schlimmes finden.
Sandra Leis [:Sie selber waren aber ein Leben lang berufstätig, haben einen Sohn großgezogen, sind spät dann auch Professorin geworden. Wie wichtig war denn Ihnen persönlich, Sie sind heute 82 Jahre alt, Karriere und vor allem auch finanzielle Unabhängigkeit?
Margit Osterloh [:Ich vermute, dass ich sage, was viele Frauen sagen, dass die Karriere eigentlich nicht geplant war, sondern dass es sich immer so ergeben hat, step by step. Man hat einen Abschluss gemacht, war gut, und dann wurde man aufgefordert, den nächsten Schritt zu tun, und den hat man dann halt auch getan. Und genauso ist es mir auch gegangen.
Sandra Leis [:Und das, denken Sie, passiert auch diesen Studentinnen eines Tages vielleicht?
Margit Osterloh [:Das kann durchaus sein, und ich würde es mir auch wünschen.
Sandra Leis [:Nochmals kurz zurück zu diesem Shitstorm, der ja über Wochen gedauert hat. Wer hat Sie in dieser Zeit unterstützt?
Margit Osterloh [:Ja, also in erster Linie mein Mann, aber ich darf auch sagen, die Universitätsleitung der Uni Zürich hat uns sehr unterstützt. Die hat wirklich gezeigt, was Wissenschaftsfreiheit ist und sein soll. Das war sehr schön für uns.
Sandra Leis [: Margit Osterloh [:Ausgetreten bin ich wahrscheinlich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, und das war so mehr zeitgeistig. Also ich kann dazu nicht viel sagen. Heute ist es mir eher unangenehm, dass es so war. Und eingetreten bin ich dann wieder im Jahre 2017. Das weiß ich genau. Das habe ich nämlich nachgeprüft.
Sandra Leis [:Und was war da der Grund, der Auslöser?
Margit Osterloh [:Eigentlich auch wieder mehr so rationale Überlegungen. Ich sage Ihnen mal, was ich gerne sage und was die Leute immer überrascht. Ich habe gesagt, ich will wieder Kirchensteuern bezahlen. Es gibt noch ein paar andere Gründe, aber ich finde eben die Kirche ist eine so wichtige Institution für unser Land, für die Sozialisation und für unsere Kultur, und die muss halt auch finanziert werden, und da müssen die Leute, die gut verdienen, ihr Scherflein dazu beitragen.
Sandra Leis [:Ihre Kernaussage in diesem Gastbeitrag, die heißt: Man muss nicht glauben, um in der Kirche zu sein. Wie meinen Sie das?
Margit Osterloh [:Ja, ich meine, man muss nicht an die jungfräuliche Empfängnis von Maria glauben, man muss nicht mal dran glauben, dass Jesus tatsächlich gelebt hat. Jesus als Symbolfigur, so wie er dargestellt ist in der Bibel, ist unglaublich wichtig und wie das in der Geschichte überliefert wird. Das ist unglaublich wichtig, und das ist auch dann wichtig, wenn man nicht an den dreieinigen Gott glaubt.
Sandra Leis [:Sie nennen drei Gründe in Ihrer Argumentation, lassen Sie uns die benennen. Grund eins, die christliche Botschaft, nämlich dass wir den Nächsten lieben sollen wie uns selbst. Das sei die zentrale Botschaft. Warum ist für Sie diese Botschaft der Nächstenliebe so essentiell?
Margit Osterloh [:Weil es kein friedliches Zusammenleben gibt, wenn man diese oder ähnliche Botschaften nicht verinnerlicht.
Sandra Leis [:Und wie leben Sie das konkret in Ihrem Alltag?
Margit Osterloh [:Nun ja, auch mit dem, was ich beruflich mache, was ich als Forschung mache, suche ich mir schon immer Themen aus, von denen ich glaube, dass sie anderen Leuten nützlich sind, dass es nicht Glasperlenspiele sind, die niemanden nützen. Und natürlich bin ich auch im karitativen Bereich engagiert. In solchen Dingen spielt sich das dann bei mir ab.
Sandra Leis [:An welche wissenschaftliche Forschung denken Sie jetzt konkret? Können Sie ein, zwei Beispiele nennen, neben der Studentinnen-Studie, die ja auch für Empörung gesorgt hat?
Margit Osterloh [:Wir haben zusammen mit meinem Mann über Zufallsverfahren gearbeitet. Und Zufall ist das demokratische Verfahren schlechthin, das den Menschen wirklich ein hohes Ausmaß an Partizipation und demokratischer Mitbestimmung gibt. Aristoteles war der Meinung, nur Zufallsverfahren können eine wirkliche Demokratie begründen. Und das ist mir ein großes Anliegen. Die Demokratie, die direkte Demokratie in der Schweiz. Aber eben auch die Steigerung dieser Mitbestimmungsmöglichkeiten von Menschen mit einem Zufallsverfahren.
Sandra Leis [:Und da geht es ja auch darum, beispielsweise bei Bewerbungsverfahren, dass man eine Auswahl trifft von hoch qualifizierten Menschen, und am Schluss soll der Zufall entscheiden. Sie haben ja darüber auch schon geschrieben. Das finde ich eine hoch interessante und spannende Idee.
Margit Osterloh [:Da ist es allerdings ein bisschen anders als im Griechenland in der Zeit von Aristoteles. Da muss jeweils eine Vorauswahl getroffen werden, eine Shortlist. Und wenn man aus dieser dann per Zufall den Sieger auswählt, dann hat das eine Reihe von positiven Eigenschaften, über die wir auch Forschungen gemacht haben. Die erste positive Eigenschaft, und da habe ich einen Aufsatz mit Katja Rost veröffentlicht, ist, ein Zufallsverfahren mindert die Hybris. Jemand, der zufällig ausgewählt ist, denkt nicht, dass er oder sie die Allergrößte ist. Oder das Genie. Und ich glaube, es wäre viel Leid in der Menschheit vermieden worden, wenn man genau diese Hybris bei den jeweils Herrschenden hätte vermeiden können. Also das ist schon mal der erste wichtige Vorteil, es macht bescheidener. Der zweite wichtige Vorteil ist, dass Minoritäten sich sonst weniger bewerben auf solche Positionen. In dem Fall, in dem wir es im Experiment gezeigt haben, waren es Frauen, dass die, wenn ein solches Zufallsverfahren etabliert wird, sich dann genau gleich bewerben wie die Männer. Das heißt also, Minoritäten werden ermutigt, sich zu bewerben, die sonst in Situationen gar nicht dran denken, dass sie sich irgendwo für einen höheren Posten bewerben könnten. Und das trägt auch zur Gleichheit bei. Und das finde ich eine ganz wichtige Maßnahme. Und dann hilft es natürlich auch viel, Ungerechtigkeiten zu vermindern. Wir alle kennen das Phänomen, dem Sieger wird gegeben und die Verlierer verlieren. Sowas wird auch ausgeglichen durch Zufallsverfahren. Es sorgt für mehr Gerechtigkeit.
Sandra Leis [:Also das ist ein Stück weit eben, dass Sie da auch mit einer solchen Forschung zur Nächstenliebe beitragen.
Margit Osterloh [:Ganz genau.
Sandra Leis [:Gehen wir zum zweiten Grund, den Sie aufführen. Sie sagen, christliche Solidarität, die brauche Gemeinschaft. Weshalb aber ist denn der institutionelle Rahmen der Kirche dafür nötig? Man könnte Gemeinschaft ja beispielsweise auch in einer kleinen Hauskirche feiern.
Margit Osterloh [:Nun hat die Geschichte gezeigt, dass die Versuche, so etwas Ähnliches aufzubauen, zum Beispiel in den kommunistischen Ländern mit der Jugendweihe und was da nicht alles gemacht wurde, das hat keine Stabilität, das ist nicht wirklich verankert. Und die christliche Kirche ist halt jahrtausendelang bei uns verankert, mit guten und mit schlechten Traditionen, aber sie ist tief in den Menschen verankert. Und das gibt ihr die Stabilität, die Institutionen brauchen. Institutionen einfach so aus der Luft in die Welt zu setzen, ist ein verdammt schweres Geschäft.
Sandra Leis [:Weil es eben dauert, bis sie auch anerkannt sind.
Margit Osterloh [:Und bis sie sich etabliert hat und bis die Legitimität anerkannt ist und bis es auch in einer gewissen Weise verinnerlicht ist. Aufgepfropfte Institutionen haben es ausgesprochen schwer.
Sandra Leis [:Am meisten überrascht oder auch gefreut hat mich der dritte Grund, den Sie erwähnt haben, nämlich die Spiritualität. Und Sie sagen, die Spiritualität, die führe im Durchschnitt zu einer höheren Zufriedenheit der Menschen und mache diese auch freundlicher und liebenswerter. Woher wissen Sie das?
Margit Osterloh [:Das ist nun wieder ein Ergebnis der Glücksforschung oder der Lebenszufriedenheitsforschung. Und da gebe ich Ergebnisse wieder, die ich nicht selber erforscht habe, sondern die von meinem Mann kommen. Bruno Frey ist ein sehr bekannter Glücksforscher. Und von ihm habe ich gelernt, dass es in der Tat so ist, dass Menschen, die gläubig sind oder die Spiritualität haben, dass die freundlicher sind und das Interessante ist: Selbst Atheisten gehen lieber mit Menschen um, die gläubig sind und die eine gewisse Spiritualität haben. Das finde ich ein überraschendes und erfreuliches Ergebnis.
Sandra Leis [:Das klingt jetzt ja alles wirklich sehr positiv, und wenn man Ihnen zuhört oder auch diesen Gastbeitrag gelesen hat, denkt man, ja eigentlich müssten ja viel mehr Leute in die Kirche eintreten, aber das Gegenteil ist ja der Fall. Wenn man die Kirchenstatistik anschaut, da sind soeben die neuesten Zahlen herausgekommen, dann sind heute die Hälfte aller Menschen, die in der Schweiz leben, in einer Landeskirche. 1970, also das ist vor 55 Jahren, da war praktisch noch jeder Mensch entweder in der katholischen oder in der reformierten Landeskirche. Wie erklären Sie sich diesen Sinkflug in einem halben Jahrhundert?
Margit Osterloh [:Es ist schwer zu erklären, vor allem angesichts der Tatsache, dass das Bedürfnis nach Spiritualität da ist und weit verbreitet ist. Und das sieht man ja auch daran, dass viele Menschen alle möglichen spirituellen Clübchen, von Yoga bis, ich weiß nicht, was, irgendwelchen Räucherstäbchen. Ja, also das Bedürfnis nach Spiritualität ist da. Und warum es die Kirchen nicht einfangen können, das kann ich Ihnen nicht wirklich sagen. Da würde ich auch gerne noch ein bisschen intensiver darüber nachdenken, inwieweit man zum Beispiel mit pädagogischer Jugendarbeit und ähnlichen dieses zweifellos vorhandene Bedürfnis nach Spiritualität und nach Gemeinschaft besser auffangen könnte.
Sandra Leis [:Weil wenn man schaut, Arnd Bünker, das ist der Leiter des SPI, das ist das Schweizerische Pastoralsoziologische Institut, der hat diese Zahlen also schon seit vielen Jahren auch wieder zusammen getragen, und er hat jetzt gesagt, wir stehen vor einem Epochenwandel und auch die sogenannte Nachwuchskirche, also quasi dass die getauften Babys, die verstorbenen Seniorinnen und Senioren ersetzen, diese Zeit, die sei jetzt vorbei, Denn es wird auch kaum mehr getauft, da sind viel weniger Taufen als früher, die sind stark rückgängig in beiden Landeskirchen, und bei den Hochzeiten ist es beispielsweise so, dass bei den Reformierten die Zahl der kirchlichen Hochzeiten sich seit 2012 halbiert hat. Also das sind wirklich Zahlen, die geben einem ja schon zu denken, und Sie selber haben sich ja intensiv in Ihrer Arbeit als Professorin mit der Organisationsentwicklung auseinandergesetzt. Gibt es einen Rat, auch wenn Sie vorhin gesagt haben, Sie wüssten’s selber gerne, aber einen Rat, bei dem Sie denken, ja, das wäre etwas, womit die Kirchen wieder Potenzial entwickeln könnten und attraktiv werden für heutige Menschen.
Margit Osterloh [:Also aus, sagen wir mal, intellektueller, wissenschaftlicher Perspektive will ich argumentieren, dass man vielleicht genau so die Gründe darlegt, wie ich sie dargelegt habe. Weil die meisten Leute sagen angeblich, wenn sie aus der Kirche austreten, sie treten deswegen aus, weil sie nicht glauben. Und meine Botschaft ist, man muss nicht glauben, um in der Kirche zu sein. Die Kirche ist eine so wichtige und nützliche Institution, auch wenn man nicht an die Dinge glaubt, die üblicherweise als Glaubenskern gedacht werden und vielleicht wenn man diese Botschaft, das ist eine sehr rationale Botschaft, wenn man die mitvermitteln würde zusammen eben mit den anderen Dingen, die ich gesagt habe, dass man eben das Bedürfnis nach Gemeinschaft und Spiritualität auffängt, vielleicht wäre das ein Weg.
Sandra Leis [:Und was sagen Sie denn, wäre es vielleicht sogar klüger, wenn man dieses Wenigerwerden, wenn ich es mal so ausdrücken darf, dieses Kleinerwerden, wenn man das akzeptieren würde und sagen würde, ja, dann wirken wir in dieser Kleinheit. Wäre das denn eine Zukunftsperspektive, denn es fehlt ja nicht nur an den Gläubigen, sondern auch am Personal. Das ist ja ganz schwierig, insbesondere für die römisch-katholische Kirche Personal zu finden.
Margit Osterloh [:Also zunächst mal bin ich überzeugt davon, dass selbst wenn die Anzahl der in der Kirche Eingeschriebenen nicht so groß ist, der Geist der Kirche wirkt in unserer Kultur, sagen wir es mal, in der abendländischen Kultur auch dann fort, wenn ein großer Teil nicht mehr Kirchenmitglied ist. Es mag allerdings einen Kipppunkt geben, der vermutlich ziemlich weit entfernt liegt, denn wie gesagt, solche Traditionen sind sehr beständig, und die wirken auch noch eine Weile. Insofern bin ich nicht ganz so pessimistisch. Ich glaube, der christliche Geist ist bei uns so tief verankert, dass er nicht leicht kaputt geht. Das wäre meine positive Botschaft. Und was war die Frage jetzt nochmal?
Sandra Leis [:Ob es auch Sinn machen würde in der Kleinheit zu wirken.
Margit Osterloh [:Ja, wie gesagt, man muss aufpassen, dass es nicht irgendwann mal einen Kipppunkt gibt. Aber den sehe ich in nächster Zukunft nicht. Den sehe ich nicht.
Sandra Leis [:Trotz dieser Zahlen?
Margit Osterloh [:Ja, trotz dieser Zahlen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass bestimmte Entwicklungen, zum Beispiel die Entwicklungen der künstlichen Intelligenz, dazu führen, dass die Leute wieder ein größeres Bedürfnis an Spiritualität entwickeln, weil sie merken, dass wir mit unserer Rationalität gar nicht so gut dastehen, dass die künstliche Intelligenz uns sozusagen, die macht es in weiten Bereichen besser und dass wir uns dann wieder auf das besinnen, was den Menschen wirklich eigen ist und was die KI nicht kann, nämlich eben Fragen der Spiritualität. Denn wie gesagt, ich habe ja nicht gesagt, dass man keine Spiritualität haben soll. Ich habe nur gesagt, man muss nicht unbedingt glauben, wenn man sich in der Kirche betätigt.
Sandra Leis [:Spiritualität ist auch ein bisschen ein schwammiger Begriff. Wie definieren Sie ihn?
Margit Osterloh [:Oh Gott, da habe ich keine präzise Definition, vielleicht das Gefühl, dass es irgendwas in der Welt gibt, das über einem drübersteht.
Sandra Leis [:Und man nicht selber der Oberste oder die Oberste ist. 2009, das ist schon ein Weilchen her, haben Sie gemeinsam mit Ihrem Mann und anderen auch noch eine Studie gemacht zu den Benediktiner Klöstern und haben sich überlegt, weshalb diese Klöster so langlebig sind, ganz anders als andere Firmen heutzutage. Das sei doch sehr beachtlich. Was ist Ihre Haupterkenntnis aus dieser Studie, die jetzt auch schon ein paar Jahre zurückliegt. Vielleicht ein Gedanke, der Ihnen bis heute sehr präsent ist.
Margit Osterloh [:Die Klöster sind die ältesten Organisationen, die wir überhaupt kennen. Älter als Universitäten, älter als alles, was wir haben. Und diese Stabilität ist ja schon bemerkenswert. Und das war vielleicht der erste wissenschaftliche Anlass, dass wir gesagt haben, da muss ja was ganz Besonderes dabei sein, dass die es wirklich so lange überlebt haben, das war der Auslöser. Und da haben wir uns dann unter anderem auch die Führungsstrukturen angeschaut. Wir haben zum Beispiel zusammen mit Emil Inauen, der damals das als Dissertation gemacht hat, eine außerordentlich gute Dissertation, haben wir in der historischen Forschung geschaut, wo sind die Äbte erfolgreicher, gemessen am Überleben des jeweiligen Klosters, Äbte, die intern oder die extern berufen wurden. Und das Ergebnis, und das hat uns erstaunt, sind die intern berufenen Äbte. Das ist jetzt zum Beispiel so ein kleiner Baustein gewesen, mit dem wir dazu beitragen wollten, zu erklären, warum die Kirche so eine stabile Institution ist, die über Jahrtausende Bestand hatte.
Sandra Leis [:Als ich das gelesen habe, dass Sie dazu geforscht haben, ist mir natürlich der Podcast in Sinn gekommen, den ich Ende Februar gemacht habe, mit Peter von Sury. Er war bis damals Abt von Mariastein, auch ein Benediktinerkloster, ist dann altershalber zurückgetreten, er wurde 75. Und er sagte im Podcast, um einen Mönch zu ersetzen, müssen wir fast drei Leute anstellen. Und weiter, ich zitiere ihn. «Die Klosterbetriebe und die Wallfahrt leben davon, dass Mönche unentgeltlich arbeiten und keinem Arbeitsgesetz unterstehen. Das heisst, sie können von morgen 6 Uhr bis abends 9 Uhr arbeiten, wenn es sein muss.» Also wenn ich so etwas höre, dann, es wundert mich dann nicht, dass es schwierig ist, Nachwuchs zu finden. Wie sehen Sie das?
Margit Osterloh [:Ich kann jetzt über dieses Kloster nichts sagen, aber es gibt ja andere Klöster, zum Beispiel Engelberg, die offensichtlich dieses Problem nicht haben, oder jedenfalls habe ich den Eindruck.
Sandra Leis [:Nachwuchsprobleme haben sie schon auch.
Margit Osterloh [:Ja, aber dieses Problem, das Sie geschildert haben, sozusagen der Ausbeutung, ja, das ist ja...
Sandra Leis [:Also das ist nur im Ausnahmefall, wenn es einmal nötig ist. Und wenn man eben jemanden anstellen müsste extern, dann muss man quasi drei Leute anstellen.
Margit Osterloh [:Ja, aber Engelberg scheint, ich weiß nichts Genaues darüber, wirtschaftlich so solide zu sein mit Immobilien und mit allem Möglichen, dass sie sich auch Leute leisten können, sodass die Mönche also nicht von früh bis spät arbeiten müssen. Und das gehörte ja früher auch immer zu den Klöstern dazu. Also das ist ja genau das, was wir da in unserer Studie auch untersucht haben. Die Überlebensfähigkeit der Klöster war immer in der Vergangenheit auch an die wirtschaftlichen Fähigkeiten des jeweiligen Abtes und seiner Brüder geheftet, und wer wirtschaftlich nichts gekonnt hat, da ist das Kloster kaputt gegangen. Sie kriegen ja auch keine Krankensteuer, sie müssen sich selber erhalten.
Sandra Leis [:Also ein Abt ist ein Manager heute, nicht?
Margit Osterloh [:Ein Abt ist ein Manager, das habe ich wirklich festgestellt.
Sandra Leis [:Das sehen Sie auch so. Dann kommen wir doch zur Bibel. In der Bibel gibt es ja zahlreiche Aussagen, die mit reichen Menschen wirklich hart ins Gericht gehen. Der wohl berühmteste Satz lautet: «Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt.» Und dieses Zitat findet man dreimal, wenn ich das richtig gezählt habe, in der Bibel. Und da wird ein Gegensatz aufgebaut zwischen Marktwirtschaft und der christlichen Botschaft. Wie stehen Sie zu solchen Äußerungen?
Margit Osterloh [:Da habe ich also lange drüber nachgedacht, warum es so ist, dass Geld und Geldverdienen in der Bibel so einen schlechten Ruf hat. Man kennt ja auch die vielen Darstellungen, wo der reiche Geldsack zusammen mit dem Teufel verschwindet, Zinsen durften früher nicht genommen werden, das ist eine interessante Frage. Und meine Antwort ist darauf, dass die Idee der Marktwirtschaft oder vielleicht und auch sogar der Sozialmarktwirtschaft, die ist erst relativ spät, nämlich im 17. Und 18. Jahrhundert, aufgekommen. Also Adam Smith, der wichtige Begründer der marktwirtschaftlichen Idee. Das gab es so vorher nicht. Vorher waren, vermutlich, das ist meine Deutung heute, ich bin keine Historikerin, dass wir früher, also vor dieser Zeit im Mittelalter und zur Zeit, zu der Jesus gelebt hat oder jedenfalls wo wir glauben, dass er gelebt hat, da waren reiche Leute vermutlich nicht sehr angenehme Leute. Wer reich war, war früher mehr oder weniger ein Ausbeuter der Armen. Erst mit der Idee der Marktwirtschaft hat sich die Vorstellung verbreiten können, dass die Marktwirtschaft gut für alle ist und dass es allen besser geht, wenn man jedem Einzelnen die Autonomie gibt, das wirtschaftlich zu tun, was er oder sie für am besten hält. Und ich glaube, diese revolutionäre Idee hat die Rolle des Reichen gleichzeitig revolutioniert. Mit der Idee von Adam Smith sind Reiche auf einmal nicht mehr die Bösewichter, sondern man kann durchaus als Unternehmer bestrebt sein, möglichst viel Gewinn zu machen, weil man Arbeitsplätze schaffen möchte, weil man gute Arbeitsplätze schaffen möchte. Weil man Gewinne machen möchte, die man hinterher weitergibt. Also das ist eine völlig neue Idee, die erst mit der Idee der Marktwirtschaft aufkommen kann.
Sandra Leis [:Das sind jetzt die rosigen Seiten der Marktwirtschaft, die Sie aufzeigen. Es gibt ja auch ganz andere.
Margit Osterloh [:Sicher, ich habe ja auch betont, soziale Marktwirtschaft.
Sandra Leis [:Sie sprechen von der sozialen Marktwirtschaft. Da muss man klar unterscheiden
Margit Osterloh [: Sandra Leis [:Das Arbeit soll sich lohnen.
Margit Osterloh [:Arbeit soll sich lohnen, und die Anreize zur Arbeit müssen erhalten bleiben. Und ich meine, wenn sich Arbeit lohnt und wenn man was kriegt, das ist ja auch eine Form von Selbstbestätigung. In unserer Gesellschaft zeigt es auch, dass man was Nützliches leistet, was die anderen gebrauchen können.
Sandra Leis [:Es gibt auch eine Unabhängigkeit.
Margit Osterloh [:Das sowieso. Das gehört ja mit zu der Idee von Adam Smith dazu. Die Abhängigen in der Vor-Adam-Smith-Zeit, die waren ja wirklich abhängig. Die waren versklavt. Die Bauern waren faktisch versklavt.
Sandra Leis [:Jetzt hat Papst Leo XIV. kürzlich sein erstes Lehrschreiben publiziert und darin die Arbeit weitergeführt oder zu Ende geführt, besser gesagt, die sein Vorgänger Franziskus begonnen hat. Und in diesem Lehrschreiben, das ist wirklich eine deutliche Kritik am Kapitalismus und gipfelt im Satz «Diese Wirtschaft tötet». Das schreibt der aktuelle Papst. Und das sind wir nun ja im 21. Jahrhundert. Können Sie das nachvollziehen?
Margit Osterloh [:Nein, überhaupt nicht. Ich muss sagen, er hat keine Ahnung von Wirtschaft und sollte sich da vielleicht besser zurückhalten. Das klingt jetzt etwas arrogant, aber diese Zusammenhänge, die ich jetzt vorhin gerade erzählt habe, die sind ja nicht so neu, die sind auch nicht von mir. Aber er könnte sich vielleicht mal, oder die beiden Päpste, könnten sich vielleicht mal ein bisschen besser informieren bei Ökonomen. Und es gibt auch übrigens sehr viel christlich orientierte Ökonomen, übrigens gerade in Italien.
Sandra Leis [:Das ist bestimmt so, das glaube ich, aber ich habe jetzt Papst Leo XIV. so verstanden, dass er diejenige Wirtschaft kritisiert, die die Würde des Menschen nicht respektiert und dass er sich vor allem daran stört, dass die Schere zwischen Reichen und Armen weiter auseinandergeht und dass es wenige Reiche gibt, die exponentiell viel verdienen.
Margit Osterloh [:Vielleicht sollte er sich mal informieren, wie die Alternativen aussehen und ob es den Leuten im Kommunismus, in Nordkorea oder im ausgeprägten Sozialismus, ob es denen besser geht. Das ist nicht der Fall. Kapitalismus heißt Autonomie für den Einzelnen, und das mag durchaus auch mit einem Auseinanderfallen von Arm und Reich zusammenhängen. Das heißt, es mag nicht nur so sein. In einigen Ländern ist es so krass, dass ich das auch nicht gut finde. Amerikanische Verhältnisse wollen wir nicht haben. In der Schweiz ist der Unterschied zwischen Arm und Reich faktisch nicht größer geworden, schon gar nicht nach Transferleistungen, also nach Ausgleichsleistungen. Das muss man sich mal zu Gemüte führen und dieses ständige Gerede von der Ungleichheit, ich kann es schon nicht mehr hören, weil es für uns in der Schweiz einfach nicht stimmt.
Sandra Leis [:Über welchen Zeitraum überblicken Sie das jetzt, dass das so immer gleichgeblieben ist in der Schweiz jetzt?
Margit Osterloh [:Ja da gibt es große Unterschiede schon zeitlich. Also immer nach allen Kriegen, übrigens nicht nur in der Schweiz, ist die Ungleichheit zurückgegangen, um dann wieder, wenn Frieden ist, wieder anzusteigen. Das ist eine Nebenwirkung von Friedenszeiten, die aber Wirtschaftshistoriker sehr viel besser erklären können als ich. So ist es. Wie gesagt, das stimmt in sehr vielen Ländern. Stimmt aber nicht für die Schweiz. Die Schweiz mit ihrer direkten Demokratie hat einen hervorragenden Mechanismus, um die Auswüchse an Ungleichheit zu verhindern. Und wenn ich noch mal zurückkommen darf auf die zwei Päpste, von denen ich frech sage, sie haben von Wirtschaft keine Ahnung. Max Weber, der große deutsche Soziologe, hat die wichtige Unterscheidung gemacht zwischen Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Gesinnungsethik heißt, dass man bestimmten Prinzipien folgt, zum Beispiel den Prinzipien, wie sie in den zehn Geboten festgelegt sind. Verantwortungsethik heißt, dass man nicht nur Prinzipien als solchen folgt, sondern dass man auch guckt, was hat das denn für Folgen? Und das kann nachher zum Beispiel zu der schlimmen oder vielleicht manchmal auch unvermeidbaren Folge führen, dass man einen Tyrannenmord begehen muss. Also das sind jetzt ethische Grenzfragen, die ich hier diskutiere. Das sind große Fragen, aber ich will damit nur sagen, Verantwortungsethik heißt, dass ich auch immer auf die Folgen dessen achten muss, was ich als Prinzip gerne sozusagen durchhalten möchte. Und die Wirtschaft oder die Ökonomik ist die Wissenschaft von der Verantwortungsethik. Und ja, wahrscheinlich sind die Päpste sozusagen Spezialisten für Gesinnungsethik.
Sandra Leis [:Und Moral.
Margit Osterloh [:Und Moral, ja.
Sandra Leis [:Margit Osterloh, zum Schluss unseres Gesprächs. Sie haben sich öffentlich zur Institution Kirche bekannt. Wie erleben Sie die Kirche ganz konkret in Ihrem Leben?
Margit Osterloh [:Nun ja, ich darf ruhig sagen, dass wir beide, mein Mann und ich, wir sind große Freunde von Kirchen, insbesondere romanischen und gotischen Kirchen. Wir lassen keine Kirche aus. Wir sind nicht furchtbar eifrige Gottesdienstbesucher, aber wir sind vom Geist, der in diesen Kirchen verwirklicht ist, schon sehr beeindruckt und lassen wenige aus.
Sandra Leis [:Im Vorgespräch haben Sie mir noch verraten, dass Sie beide auch regelmässig ins Kloster Engelberg gehen.
Margit Osterloh [:Also nicht bloß Engelberg, also wir waren in Disentis, wir waren in Engelberg, wir waren in verschiedenen Klöstern und versuchen auch immer so ein bisschen am klösterlichen Leben teilzunehmen, in aller Bescheidenheit. Nicht früh um fünf, aber bei der Abendmesse sind wir dann schon dabei, und das gefällt uns, das tut uns gut.
Sandra Leis [:Vielen Dank für dieses Gespräch und auch diese Informationen über die Wirtschaft, darüber können wir nachdenken. Vielen Dank Ihnen, Margit Osterloh.
Margit Osterloh [:Es war mir ein großes Vergnügen.
Sandra Leis [:Das ist die 57. Erfolge des Podcasts «Laut + Leis». Zu Gast war Margit Osterloh, emeritierte Wirtschaftsprofessurin der Universität Zürich. Heute ist sie Forschungsdirektorin eines kleinen privaten Instituts. Es heisst CREMA. Über Feedback freuen wir uns. Schreibt gerne per Mail an podcast@kath.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. Und abonniert den Podcast und bewertet ihn positiv, wenn er euch gefällt. In der nächsten Folge des Podcasts «Laut + Leis» spreche ich mit Monika Renz. Die bekannte Sterbeforscherin und Theologin hat ein neues Buch geschrieben mit dem Titel «Meine Hoffnung lass’ ich mir nicht nehmen». Darin heisst es: «Hoffnung ist nicht an gute Gegebenheiten gebunden, sie ist Entscheidung und Geschenk.» Bis in zwei Wochen und bleibt laut und manchmal auch leise.