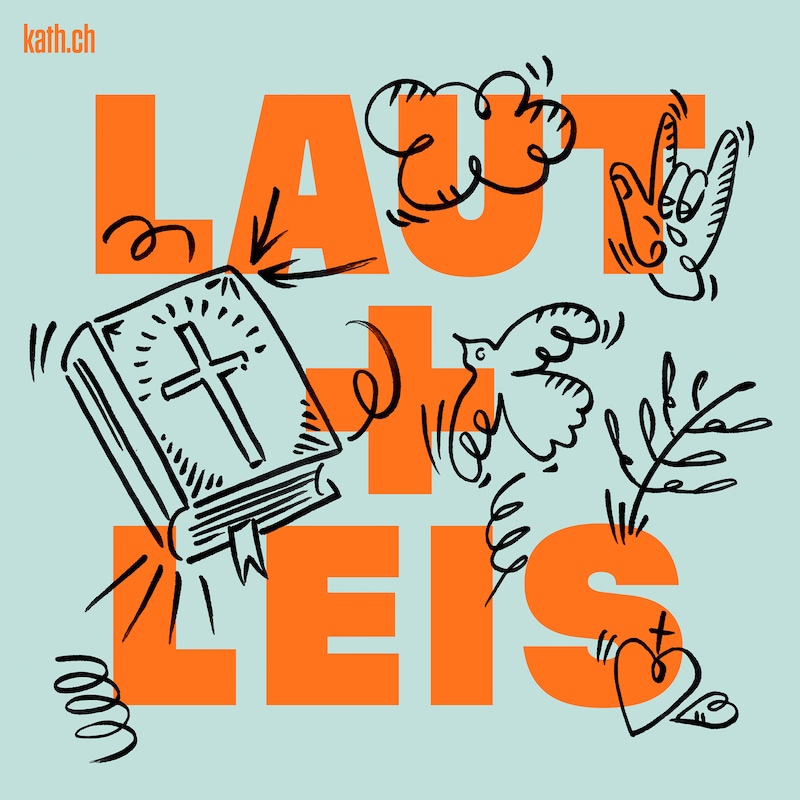
Shownotes
Wo steht die katholische Kirche Schweiz zwei Jahre nach der Veröffentlichung der Pilotstudie zum sexuellen Missbrauch? Urs Brosi, Generalsekretär der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz, über Missbrauch, Reformen, Kulturwandel und den steinigen Weg, Vertrauen zurückzugewinnen.
Die Themen dieser Folge:
- Sieht sich die Römisch-Katholische Zentralkonferenz (RKZ) als Aufsichtsorgan der Schweizer Bischofskonferenz (SBK)?
- Ist finanzieller Druck auf die Bischöfe sinnvoll?
- Wie sensibilisiert die RKZ ihre Mitglieder, also Landeskirchen und Kirchgemeinden, für das Thema Missbrauch?
- Was taugen die Assessments, mit denen angehendes kirchliches Personal seit April 2025 durchleuchtet wird?
- Charles Morerod, Präsident der SBK, führt in seinem Bistum für Priester einen Ausweis mit QR-Code ein. Was hält Urs Brosi von dieser Idee?
- Wann nimmt das geplante nationale Kirchengericht seine Arbeit auf?
- Weshalb gibt es in der Zentralschweiz, in der Romandie und im Tessin noch keine unabhängigen Opferberatungsstellen?
- Findet aus Sicht der Interessengemeinschaft «Missbrauch im kirchlichen Umfeld» (IG MikU) ein Kulturwandel statt?
- Braucht es für einen echten Kulturwandel nicht auch systemische Anpassungen in der Kirche, zum Beispiel eine Gewaltenteilung?
Transcripts
Gerade im Zusammenhang mit Missbrauch, es braucht etwas mehr, das ins Systemische eingreift. Die Veränderung muss letztlich auch ein Stück weit abgetrotzt werden. Also ich kenne kein monarchisches System, bei dem der Monarch einfach aus innerer reifer Überzeugung Macht abgegeben hat.
Sandra Leis [:Das sagt Urs Brosi. Der Theologe und Kirchenrechtler ist Generalsekretär der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz, kurz RKZ. Das ist der Dachverband der katholische Kantonalkirchen. Zwei Jahre ist es nun her, dass die Pilotstudie zum Missbrauch im Umfeld der römisch-katholischen Kirche publiziert wurde. In dieser Folge des Podcasts «Laut + Leis» fragen wir: Wo steht die Kirche heute? Findet tatsächlich ein Kulturwandel statt? Und wie kann verlorenes Vertrauen wieder aufgebaut werden? Das Generalsekretariat der RKZ hat seinen Sitz in Zürich. Ich bin Sandra Leis und spreche vor Ort mit Urs Brosi. Urs Brosi, herzlich willkommen zu unserem Gespräch.
Urs Brosi [:Danke sehr für die Einladung.
Sandra Leis [:Blenden wir zwei Jahre zurück, 12. September 2023. Du warst seit neun Monaten im Amt als Generalsekretär der RKZ. Auf dem Programm stand die Medienkonferenz. Viele Medien waren vor Ort, interessierten sich dafür. Mit welchem Gefühl bist du am Morgen an diese Medienkonferenz gegangen?
Urs Brosi [:Das weiß ich noch relativ gut. Ich war natürlich angespannt. Das ist klar, wir haben lange vorbereitet. Ich war zugleich aber auch erwartungsvoll, dass dieser Tag wichtig würde und uns als Kirche weiterbringt. Unterwegs im Tram habe ich Vreni Peterer angetroffen. Wir gingen dann ein Stück weit gemeinsam.
Sandra Leis [:Von der Opferberatungsstelle.
Urs Brosi [:Ja, genau. Sie ist die Vertreterin der Missbrauchsbetroffenen in der Deutschschweiz, der IG MikU, Präsidentin, und hat an der Medienkonferenz auch gesprochen. Für mich war es das Gefühl auf diesem Weg, ich hoffe, dass bei allem Schmerz, den diese Studie auslöst, dieser Tag bewirkt, dass es für die Missbrauchsbetroffenen langfristig ein guter Tag wird.
Sandra Leis [:Die Ergebnisse, die waren schockierend: Das Team um die beiden Forscherinnen, Historikerinnen Monika Dommann und Marietta Meier haben über tausend Fälle von sexuellem Missbrauch aufgedeckt in den Jahren 1950 bis 2020. Und sie sagten noch, das sei nur die Spitze des Eisbergs. Hast du ob diesen Ergebnissen je daran gedacht, deine Stelle wieder aufzugeben?
Urs Brosi [:Ich hatte für mich einen kritischen Moment, aber der lag fünf Jahre zuvor, 2018, als in Deutschland die MHG-Studie publiziert worden ist. Damals habe ich mich mit den Ergebnissen dieser Studie befasst, und da war mir wirklich einige Tage lang übel. Also das weiß ich noch, das hatte dann sogar körperliche Symptome mit sich genommen, und ich war tief betroffen, weil mir in dem Moment auch bewusst wurde, wenn das jetzt nicht mehr USA ist und Irland, sondern Deutschland ist, dann wird die Situation bei uns nicht wesentlich anders sein. Also von daher, ob der Zahl selber war ich nicht direkt schockiert, aber natürlich ist es im Moment, das so zu hören, auch so die einzelnen Ergebnisse, es tut einfach enorm weh.
Sandra Leis [:Und die Studie zu lesen, das ist ja auch schon sehr bedrückend. Wichtig ist ja noch zu wissen oder sich daran zu erinnern, den Auftrag gegeben haben für diese Studie die RKZ, die Schweizerische Bischofskonferenz (SBK) und die KOVOS, also das ist die Vereinigung der Ordensgemeinschaften. Urs Brosi, jetzt würde mich schon auch interessieren, in welchem Verhältnis stehen denn die Römisch-Katholische Zentralkonferenz und die Schweizer Bischofskonferenz, das sind die beiden Hauptplayer im Ganzen.
Urs Brosi [:Ich würde heute sagen, dass wir ein sehr kooperatives und respektvolles Verhältnis miteinander pflegen. Es ist intensiv geworden. Ich wage zu behaupten, dass die Missbrauchsthematik mehr Einfluss hatte auf unsere Zusammenarbeit als manche Studien und Verträge, die man in den letzten Jahren zu dieser Beziehung angestellt hat. Wir mussten uns wohl oder übel miteinander auseinandersetzen. Es gab Friktionen, die sind auch öffentlich bekannt, und im Moment würde ich sagen, sind wir sehr konstruktiv unterwegs. Wir haben natürlich unterschiedliche Interessen, also das ist ja institutionell auch gegeben, aber wir sind doch so miteinander in Verhandlung, dass es nicht primär um Macht, um die Machtfrage geht, sondern wie schaffen wir es mit den unterschiedlichen Interessen, das gemeinsame Ziel, das uns ja verbindet, irgendwie zu erreichen. Und was ich auch spüre, ist, dass auf der persönlichen Ebene eine gute Vertrauensbasis entstanden ist.
Sandra Leis [:Du hast es gesagt, SBK und RKZ sind sich keineswegs immer grün oder immer grün gewesen. Sieht sich denn die RKZ manchmal auch als eine Art Aufsichtsorgan der Bischöfe?
Urs Brosi [:Ja, offiziell sicher nicht.
Sandra Leis [:Offiziell spricht man vom dualen System.
Urs Brosi [:Offiziell spricht man vom dualen System, und da kann ich sagen, ich habe selber so zwei Blickrichtungen darauf. Die eine ist einmal von der staatlichen Seite her, dass die RKZ vertritt ja zumindest in der Deutschschweiz die öffentlich-rechtlichen Körperschaften, also die Kirchgemeinden und die Landeskirchen. Und die haben die Verantwortung, für die mit Hilfe der Kirchensteuer erhobenen Finanzmitteln die Verwendung zu bestimmen. Und das Zweite, das ihnen gemeinsam ist, sie sind Arbeitgeber für die große Mehrzahl der kirchlichen Mitarbeitenden und haben damit Recht und Pflichten. Und diese Punkte lassen sich nicht irgendwie wegwischen, die bleiben, egal wie man dieses duale System definiert, auf dieser Seite. Auf der anderen Seite ist natürlich der Anspruch viel umfassender. Die katholische Kirche geht in ihrem Recht immer noch davon aus, dass Papst, Bischof, Pfarrer auf ihrem jeweiligen Arbeitsfeld eine umfassende Zuständigkeit haben. Und jetzt haben wir in den letzten Jahren im Rahmen des von Papst Franziskus angestoßenen synodalen Prozesses gewisse Veränderungen erlebt. Ich verweise auf das Schlussdokument der Weltsynode vom letzten Oktober. Wo die Bereiche Evaluationspflicht drin waren, Rechenschaftspflicht der Amtsträger gegenüber dem Volk, etwas doch relativ Neues als Aussage. Und wie ich gehört habe von Helena Jeppesen, dass innerhalb der Versammlung es auch weiter ging, dass man sogar auch die Forderung aufgestellt hat, die dann nicht im Schlussdokument war, nach einer Gewaltenteilung. Und das ist für mich auch sachlich irgendwo richtig. Also wir können nicht Aufsicht verhandeln, wenn es, wie wir heute im unternehmerischen Bereich sagen, nicht eine Check-and-Balance gibt, also ein Ausgleich der Kräfte von sich gegenüberstehenden Organen.
Sandra Leis [:Aber so weit ist die römisch-katholische Kirche überhaupt nicht.
Urs Brosi [:Soweit ist die Kirche nicht, und jetzt kommt so der Satz von unserer Seite her: Wir nehmen ein Stück weit in dieser Situation ersatzweise ein Gegenüber wahr.
Sandra Leis [:Kurz nach der Veröffentlichung der Pilotstudie hat die Luzerner Kirchgemeinde Adligenswil mit ihren knapp 3000 Katholikinnen und Katholiken vorderhand mal keine Kirchensteuern mehr ans Bistum Basel abgeliefert. Und andere Luzerner Gemeinden sind dem Beispiel gefolgt. Was hältst du von solchen Aktionen?
Urs Brosi [:Das Präsidium der RKZ hatte vier Tage nach dieser Medienkonferenz auch einen solchen Beschluss gefasst, nicht, dass man direkt das Geld kürzt, aber dass man eine solche Sanktion in den Raum stellt für den Fall, dass sich zu wenig bewegen lässt. Und die Delegierten haben das Präsidium aber in dieser Hinsicht dann korrigiert und gesagt, wir wollen keine Sanktionsdrohung im Raum haben. Wir haben deswegen die letzten Jahre versucht, ohne eine solche Sanktionsdrohung vorwärts zu kommen. Die Stimmung vor zwei Jahren war wirklich von einem immensen Vertrauensverlust geprägt, weil es war ja nicht nur diese Studie, es waren zugleich einige Enthüllungen ringsherum, die nicht unmittelbar mit der Studie zu tun hatten, so insbesondere auch, dass es eine von Rom in Auftrag gegebene Untersuchung gegen vier Mitglieder der Bischofskonferenz gibt und andere Vorkommnisse mehr. Der Bericht des «Beobachters» ein Monat zuvor, im Fall der sogenannten Denise Nussbaumer aus dem Bistum Basel. Ja, all dies hat dazu beigetragen, dass wirklich die Frage war, können wir da den Bischöfen noch irgendwie vertrauen? Reden die nur schön? Und wollen quasi einfach das Problem irgendwie verharmlosen und wegsprechen, aber möglichst nicht strukturell etwas verändern. Und in dieser Phase waren einige auch auf unserer Seite überzeugt, es braucht mehr und zwar klaren Druck.
Sandra Leis [:Finanziellen Druck. Urs Brosi, also ich will die Bischöfe keineswegs in Schutz nehmen. Sie müssen Verantwortung tragen. Gleichzeitig finde ich es aber auch ein bisschen zu simpel, wenn Kirchgemeinden und Landeskirchen die Verantwortung einfach an die Bischöfe delegieren. Werden wir konkret: Wie sensibilisiert denn die RKZ ihre Mitglieder und damit eben auch die Kirchgemeinden, also die Basis, für das Thema Missbrauch?
Urs Brosi [:Also das Thema, glaube ich, ist in den letzten zwei Jahren weit zur Basis hinuntergekommen, wenn auch eben auf einem schmerzhaften Weg, insbesondere auch durch die hohe Zahl der Kirchenaustritte, die wir im vierten Quartal des Jahres 2023 hinnehmen mussten. Was wir tun, ist, insbesondere im Rahmen der Maßnahmen, immer mitbedenken, dass auch Kirchgemeinden, Landeskirchen mit in der Verantwortung stehen, und zwar insbesondere eben in dieser Rolle als Arbeitgeber. Und als Arbeitgebende tragen sie natürlich eine Verantwortung nicht nur für die Personen, die sie anstellen, sondern haften gegebenenfalls auch für den Schaden, den die diese Mitarbeitenden verursachen, und haben eine Fürsorgepflicht für die Menschen, die sich in ihrem Kontext, also in einer Pfarreikirchgemeinde, aufhalten. Und eine der Maßnahmen, wo jetzt die Kirchgemeinden konkret gefordert sind, ist im Bereich der Personaldossiers, wo wir möchten, dass sie aktiver werden bei der Anstellung mit dem Einholen von Referenzauskünften. Das ist bislang bei Seelsorgerinnen und Seelsorgern, insbesondere bei Priestern, so gut wie nicht der Fall. Und wir möchten, dass Kirchgemeinden diese Verantwortung wie ein normaler Arbeitgeber wahrnehmen. Und das bedingt aber, dass die früheren Arbeitgebenden auch wissen, was sie sagen dürfen. Weil es kommt ja bislang nur in wenigen Fällen zu einer gerichtlichen Vorurteilung. Vielfach gibt es Vorkommnisse, die intern irgendwie geklärt wurden, die man angegangen ist. Und dann ist die Frage, ist das jetzt etwas, was ich einem zukünftigen Arbeitgeber sagen darf oder nicht sagen darf. Und in diesem Verhältnis zwischen Persönlichkeitsschutz, aber auch Informationspflicht über wichtige Ereignisse versuchen wir, mit einem Leitfaden mitzuhelfen, dass hier etwas mehr Klarheit entsteht. Und eben auch der Fürsorgepflicht gerecht getan werden.
Sandra Leis [:Dieser Leitfaden, der wird im Moment, an dem wird gearbeitet, der ist noch nicht da. Nehmen wir an, er kommt, ich hoffe bald, es war mal angekündigt im Sommer 25, also jetzt. Wenn er dann da ist, wie kontrolliert die RKZ, ob die einzelnen Kirchgemeinden sich an diesen Leitfaden halten?
Urs Brosi [:Der Leitfaden, wie es der Name sagt, ist kein Gesetz, sondern ist der Versuch eines gewissen Standards und auch ein Hinweis, wie man eben insbesondere mit diesen sensiblen Informationen umgehen soll. Was wir nicht direkt kontrollieren können, aber was eigentlich das Anliegen dahinter ist, ist eben, dass nicht nur die Personaldossiers gut geführt werden, auch in den Bereichen, wo es eben dann schwierig wird. Also dann die Frage eben, worüber macht man jetzt eine Aktennotiz, wie sieht die aus, was beinhaltet die?
Sandra Leis [:Und gibt man sie weiter.
Urs Brosi [:Und welche Informationen gibt man dann weiter. Aber der entscheidende Punkt ist dann die Frage, ob ein neuer Arbeitgeber auch interessiert ist, das in Erfahrung zu bringen und eben eine Referenzauskunft einfordert. Das System ist ja dann so ganz üblich in der Schweiz, dass ich nicht einfach als potenziell neuer Arbeitgeber den früheren anrufen darf und sagen darf, ich habe im Lebenslauf gesehen, dass die Person bei Ihnen gearbeitet hat. Sondern ich muss den Bewerber, die Bewerberin um Referenzauskünfte fragen und dann darum ersuchen, dass sie mir auch den früheren Arbeitgeber anzufragen ermöglicht. Aber dahin sollten wir kommen. Und ich, auf deine Frage zurück, kontrollieren können wir das in dem Sinn nicht.
Sandra Leis [:Das ist ja ein bisschen die Crux am Ganzen. Man kann Leitfäden schreiben, Organigramme, weiß ich was alles. Und ja, wie bringt man es dann eben zur Basis, dass sie das wirklich ernst nimmt und, wie du sagst, Referenzen einholt zum Beispiel.
Urs Brosi [:Ich glaube, ein Punkt, der uns in den nächsten Jahren, wenn ich jetzt sage, helfen wird, es ist etwas seltsam ausgedrückt, aber aus Schaden wird man klug.
Sandra Leis [:Hoffen wir es.
Urs Brosi [:Bislang hatten wir den Großteil der Personen, die sich gemeldet haben, die einen Missbrauchsfall vor Jahrzehnten erlebt haben. Also die einen sehr, sehr langen Weg zurücklegen, bis sie damit an die Kirche gelangen und gegebenenfalls an die Öffentlichkeit. In Zukunft wird es nicht mehr so lange dauern.
Sandra Leis [:Aber auch heute gibt es noch Priester, die wechseln von einem Bistum zum anderen. Das ist ja nicht etwas, was 20, 30 Jahre zurück ist. Es gibt aktuelle Beispiele. Ich zähle die jetzt nicht alle auf, aber das wissen wir beide ganz genau.
Urs Brosi [:Ich sage, die Veränderung, die jetzt kommt, ist, dass die Haftungsfrage für die Arbeitgeber kommen wird. Also wenn ich eben einen Priester vor 80 Jahren beschäftigt habe, dann ist das nicht mehr dasselbe, wie jetzt die Frage, was ist, wenn ich sagen muss, unsere Kirchgemeinde hat vor fünf Jahren eine Person angestellt und die Vorsichtsmaßnahmen, Strafregisterauszüge, Referenzauskünfte nicht eingeholt und einfach gesagt, ja, schön, dass wir überhaupt wieder jemanden bekommen.
Sandra Leis [:Genau, weil Personalmangel ist ja auch ein Thema.
Urs Brosi [:Das ist ein großes Thema, und das macht die Sache jetzt auch anspruchsvoll, das ist so. Und dass man aber sagt, und wenn man aber weiß, dass man als Kirchgemeinde dann eben auch haften kann, dann glaube ich, dann lernt man schon über diesen Druck, dass es vielleicht klüger wäre, sich vorher darum zu kümmern, bevor der Schaden angerichtet ist.
Sandra Leis [:Charles Morerod, der Präsident der Schweizer Bischofskonferenz, der hat im Juli in der NZZ eine Bombe platzen lassen. Man muss es fast so sagen. Er hat nämlich gesagt, dass er in seinem Bistum, also in Lausanne, Genf und Freiburg, einen Ausweis mit QR-Code einführen wird. Also da ist er dran. Und dass er das auch möchte für die ganze Schweiz. Was hältst du von so einer Idee? Also das wäre ein nationales Register, wo man dann mit dem Smartphone den QR-Code anklicken kann und schauen kann, was ist mit dieser Person, mit diesem Priester oder dieser Seelsorgerin, was hat die für eine Vergangenheit. Offenbar gibt es dann da Rot, Orange und Grün. Es gibt diese drei Abstufungen. Was hältst du von dieser Idee des Präsidenten der Schweizer Bischöfe?
Urs Brosi [:Ich bin positiv davon angetan, insbesondere weil Frankreich ja damit jetzt bereits seit ein paar Jahren unterwegs ist und zeigt, dass das eine Form sein kann. Es basiert ja darauf, dass die Kirche diesen Ausweis, ursprünglich ein Schreiben, offiziell auch vorschreibt. Also für Priester, die sich außerhalb des eigenen Bistums bewegen, die müssen von ihrem Bischof ein solches Schreiben, man nennt das Celebret, bekommen. Und jetzt wird das derzeit entsprechend eben im Kreditkartenformat gebracht und die entscheidende Neuerung, die Frankreich einführt, ist, dass darauf jetzt eben ein QR-Code ist, mit dem man einen Abgleich mit einem zentralen Register machen kann, sodass der Ausweis, auch wenn er vielleicht schon einige Jahre alt ist, auf seine aktuelle Geltung hin überprüft werden kann. Also ob inzwischen jemand zwar einmal gültig zum Priester geweiht worden ist, aber aufgrund kirchlicher Sanktionen gesperrt ist. Oder, das wäre dann die Marke Orange, dass er zwar weiter als Priester wirken kann, aber mit Einschränkungen, was der Bezug beispielsweise zu Minderjährigen anbelangt. Und ich denke, dass das eine praktikable Form ist. Das Entscheidende wird sein, diese ganzen Überlegungen anzustellen bezüglich Datenschutz. Also wer gibt die Daten ein, wer kontrolliert, ob die aktuell sind und so weiter. Das wird die wesentliche Aufgabe sein. Aber ansonsten bin ich der Idee grundsätzlich sehr wohlgesinnt.
Sandra Leis [:Bleiben wir noch mal kurz bei der Rekrutierung des Personals: Seit April 2025, also ganz neu, wird angehendes kirchliches Personal mit Assessments durchleuchtet, ein Stück weit. Ist es bereits vorgekommen, dass man Bewerber oder auch Bewerberinnen abgelehnt hat wegen des Ergebnisses im Assessment?
Urs Brosi [:Nach meiner Kenntnis kam es noch zu keinem Fall, bei dem die Psychologinnen und Psychologen eine Ablehnung empfohlen haben. Man muss ja immer sagen, die entscheiden es nicht selber, sie machen einen Bericht mit einer Empfehlung. Das Assessment hat auch zwei wesentliche Zielrichtungen, die man unterscheiden muss. Das eine ist die Frage, sind die für eine Seelsorgetätigkeit erforderlichen Kompetenzen einigermassen ausreichend vorhanden, das ist Empathiefähigkeit, das ist Pro-Sozialität, das ist Kommunikationsfähigkeit, und auf der anderen Seite sind die Eigenschaften, die erfahrungsgemäß zu einer Gefährdung führen können. Das sind Umgang mit Konflikten, die in Gewaltausbrüchen kommen, das Ausnutzen von asymmetrischen Verhältnissen zum eigenen Vorteil. Das kann sexueller Art sein, aber das kann auch finanzieller oder anderer Art sein.
Sandra Leis [:Oder spiritueller Missbrauch, alles Mögliche.
Urs Brosi [:Und dass solche Muster für problematische Eigenschaften abgeklärt werden, ob man die findet.
Sandra Leis [:Personalmangel, ich habe es vorhin schon angesprochen. Könnte es auch sein, dass man da mal ein Auge mehr zudrückt als normal?
Urs Brosi [:Also das ist ja die Gefahr, die im Raum steht, und deswegen meinen wir auch, dass es eine gewisse Kontrolle braucht bei jenen, die dann entscheiden. Nicht, weil die jetzt per se böse entscheiden wollten oder verantwortungslos wären, sondern weil man in diesem Dilemma natürlich eher dazu neigt, eine gewisse Großzügigkeit walten zu lassen. Wenn man von extern beraten wird, dann hört man grundsätzlich den Ratschlag, gerade weil ihr Personalmangel habt, solltet ihr nicht jede Person nehmen, weil das die ganze negative Situation noch beschleunigt. Also ihr müsst einen gewissen Standard haben. Aus meiner Sicht ist der Standard aber nicht alleine durch die akademische Ausbildung gegeben. Da bin ich selber, ich war als Student da etwas eingebildeter, was eine akademische Ausbildung bewirkt, ich bin zurückhaltender geworden, weil ich merke, dass es viele Personen gibt, die sehr gut in der pastoralen Arbeit funktionieren ohne ein Hochschulstudium. Aber ich glaube, andere Eigenschaften, eben gerade im Bereich der Empathie, der Fähigkeit auf Menschen zugehen zu können, sich echt sozial zu interessieren, wie es anderen Menschen geht, das sind wesentliche Voraussetzungen, und da müssen wir auf die Suche gehen, wo haben wir Menschen, die sich von daher eignen und zugleich auch eine Verankerung in ihrem Glauben haben.
Sandra Leis [:Das ist sicher wichtig, das glaube ich auch. Thema Verbindlichkeit, Kontrolle, eine der Maßnahmen, die leuchtet eigentlich jedem Menschen ein und die wurde auch sofort präsentiert vor zwei Jahren, nämlich, dass künftig nichts mehr geschreddert werden darf, also keine Dokumente im Bezug zu Missbrauch. Nur, wer kontrolliert das? Wer kontrolliert, ob irgendwo nicht doch noch Dokumente geschreddet werden?
Urs Brosi [:Also wir haben von allen Organisationen, d.h. von den Bistümern, von den Ordensgemeinschaften, von den Landeskirchen eine Selbstverpflichtungserklärung eingefordert. Und bei den Bistümern und Landeskirschen sind wir vollständig, bei den Ordensgemeinschaften nicht ganz. Aber es gibt keine Kontrolle dazu und die wäre in der Tat auch schwierig. Also wir müssten ja quasi hingehen und schauen, wo sind sensible Informationen und bleiben die dann dort. Der Punkt mit dieser Selbstverpflichtungserklärung, der ein zentraler Punkt war ja, dass es im kirchlichen Gesetz eine Verpflichtung gibt, gerade in Sachen der kirchlichen Strafverfahren auch aufzuräumen.
Sandra Leis [:Ja genau, und jetzt ist man da quasi ungehorsam.
Urs Brosi [:Genau, und dass man eben gesagt hat, ja, aber wir lernen jetzt aus dieser Erfahrung, dass gerade beim Missbrauch Minderjähriger es sehr lange dauert, bis die kommen. Und damit kann man nicht einfach sagen, dass man zehn Jahre nach der Verurteilung oder spätestens beim Tod des Täters diese Missbrauchsakten schreddert.
Sandra Leis [:Es gibt Menschen wie der verstorbene Albin Reichmuth, Vorgänger von Vreni Peterer. Er hat mit 63, habe ich jetzt in den Nachrufen gelesen, endlich mal über diesen Missbrauch sprechen können. Ich meine, da sind 50 Jahre oder noch mehr vergangen, bis er den Mut fasste oder auch das Vertrauen finden konnte, dass er über diese riesige Schandtat auch sprechen konnte. Also da ist, wie du sagst, da sind zehn Jahre nichts. Und von dem her ist das sicher eben gut, dass mit dieser Selbsterklärung. Ich möchte einfach festhalten, eine Kontrolle gibt es letztlich nicht. Positiv, würde ich jetzt mal sagen, ist die Opferberatung, weil sie jetzt bei den kantonalen Opfer-Beratungsstellen angesiedelt ist. Die Kirche bezahlt eine Fallpauschale für Beratung, wenn es gewünscht ist, gibt sie Auskunft, muss ja auch, weil ja die Opferstellen nicht immer wissen können, wie sind die kirchlichen Zusammenhänge usw. Aber hat sich dieses System, das jetzt seit Anfang Jahr gilt, hat sich das bewährt bis jetzt?
Urs Brosi [:Also, um vorauszuschicken, wir haben zwei grosse weiße Flächen auf der Landkarte. Das ist die ganze Zentralschweiz, wo wir noch keine einzige Vereinbarung abgeschlossen haben. Und das ist die Romandie inklusive Tessin. Da waren wir gerade heute Morgen in Neuenburg in einem Gespräch mit den Verantwortlichen sowohl auf der Ebene der Sozialämter als auch der Beratungsstellen. Um mit ihnen die Blockaden, die bestehen, zu besprechen. Und ich bin jetzt zuversichtlich, dass wir heute Morgen einen Schritt weitergekommen sind. Aber insofern, wenn du fragst, ob es sich bewährt hat, wir sind noch gar nicht überall wirklich zur Umsetzung gekommen. Insgesamt hat das Konzept, dass man die Beratung nicht mehr versucht über kirchliche Stellen zu führen, große positive Resonanz bekommen. Und dass wir auf unserer Seite zeigen, dass wir die Bereitschaft haben, jetzt nicht einfach so zu tun, als möchten wir die ganze Verantwortung dem Staat überlassen, sondern sagen, ja, also das eine ist eben dieser Pauschalbeitrag, den wir zu zahlen bereit sind und andererseits für die Deutschschweiz und die Romandie je eine Informationsstelle geschaffen, die die kirchenspezifischen Informationen liefern soll für die Opferberatungsstelle.
Sandra Leis [:Ich habe noch eine Frage – für mich auch noch eine Black Box – zu dem nationalen Kirchengericht. Das wird ja auch gefordert, war eine der Maßnahmen, die damals verkündet wurde. Es hieß mal Ende 2024 steht dieses Kirchengericht. Urs Brosi, wann dürfen wir damit rechnen?
Urs Brosi [:Ja, wenn das so einfach wäre mit diesen Fristen, ich kann sagen, da hat sich Bischof Joseph-Maria Bonnemain sehr dafür engagiert. Er ist da wirklich im Einsatz und es zieht sich hin und das ist nicht seine Schuld, dass es so langsam geht. Es waren Schritte zuerst nötig, welche in Rom jeweils zweimal ein Einverständnis verlangten. Und die haben jeweils wieder gedauert, bis dann wieder die Genehmigung kam für den nächsten Schritt. Jetzt bereitet die personelle Besetzung Mühe, das heisst zusammen mit den Statuten, die man in Rom zur Genehmigung einreicht, müssen alle Chargen, die da vorgesehen sind, mit einem möglichen Namen verbunden werden. Das heisst, Rom will zugleich überprüfen, ob wir denn überhaupt die fachlich kompetenten Leute hätten, um ein solches Gericht dann Wirklichkeit werden zu lassen. Das war jetzt nicht ganz einfach. Nach meinem Kenntnisstand ist Bischof Joseph jetzt da soweit gut unterwegs. Und jetzt wird es dann nochmals die Frage sein, wie lange es dauert, bis die Statuten abgesegnet sind.
Sandra Leis [:Im Vorfeld unseres Gesprächs habe ich unter anderem auch mit Vreni Peter gesprochen. Wir haben sie zu Beginn unseres Gesprächs schon erwähnt. Eben sie ist die Präsidentin der Interessengemeinschaft Missbrauch im kirchlichen Umfeld. Und ich habe sie gefragt, wie sie das empfinde, zwei Jahre danach. Und sie hat wirklich gesagt, für sie sei ein Kulturwandel spürbar. Es gehe vorwärts. Und vor allem die betroffenen Organisationen, die würden jetzt ernst genommen. Und sie werden einbezogen beim Erarbeiten von Maßnahmen. Schwierig sei es aber, dieses Vertrauen wieder aufzubauen, denn insbesondere in der Kommunikation, die sei häufig mangelhaft, die Betroffenen werden im luftleeren Raum gelassen. Sie müssen selber immer nachfragen, wo steht jetzt mein Prozess, wie weit seid ihr, muss es nach Rom oder nicht. Also bei der Kommunikation, da hapere es noch, sagt Vreni Peterer. Was glaubst du, braucht es eine obligatorische Schulung in Kommunikation?
Urs Brosi [:Es ist, glaube ich, wichtig, dass man die verantwortlichen Personen, wir sprechen ja jetzt von den kirchlichen Meldestellen, also von den Personen, die in der kirchlichen Struktur solche Meldungen entgegennehmen und dann nach innen abklären müssen. Und ich glaube, was diese Personen manchmal unterschätzen, wie es nach einer solchen Meldung im Kopf einer betroffenen Person rumort.
Sandra Leis [:Und im Herzen.
Urs Brosi [:Ja. Und dass da einige Wochen schon eine Ewigkeit sein können. Aus der Sicht der Personen, die solche Verfahren verführen, ist das wie normal. Das dauert Monate, man führt Gespräche, man macht Abklärungen, Konfrontationen usw. Hingegen, es ist eine andere Perspektive für die Betroffenen. Und ich glaube, dass diese Sensibilität in der Tat wachsen muss. Und das andere ist das, was ich vorhin so angesprochen habe, wir brauchen jetzt auch gewisse Standards, wie diese Verfahren überhaupt ablaufen.
Sandra Leis [:Ich möchte zum Schluss nochmals auf den Kulturwandel zu sprechen kommen, denn die Kirche, die kultiviert nach wie vor das Bild, dass sie systemisch eigentlich nichts zum Problem beiträgt. Braucht es denn für einen echten Kulturwandel nicht auch systemische Veränderungen, beispielsweise Gewaltenteilung?
Urs Brosi [:Aus meiner Sicht unbedingt, also da bin ich überzeugt, und das ist so der Punkt, den ich vorhin auch angesprochen habe im Zusammenhang damit, dass jetzt auch in dieser Weltsynode das ja erkannt wurde, gerade im Zusammenhand mit Missbrauch, es braucht etwas mehr, das ins Systemische eingreift. Es ist aus meiner Erfahrung ja bei vielen Themen immer beides, also es braucht immer die entsprechenden Strukturen und die Kultur, also so, wenn man es etwas ausdrücken will, die Hardware und die Software, die Kultur ist das Weiche, die Einstellung, wie geht man damit um, eben welche Sensibilität ist auf gewisse Themen vorhanden. Mit welcher Werthaltung, also ist mir jetzt der Schutz der eigenen Institution das Wichtigste oder sage ich nein, der Schutz vor Missbrauch ist mir das Wichtigste. Solche Werte müssen entsprechend geschaffen sein, und da glaube ich auch, also da bin ich froh, wenn das Vreni Peterer aus ihrer Sicht so sagen kann, dass wir da einen wesentlichen Entwicklungsschritt in den letzten Jahren gemacht haben. Und das andere tut aber nach wie vor Not, dass wir nämlich wirklich auch systemisch, in den kirchlichen Strukturen die Veränderungen so machen, um zu vermeiden, dass es auch wieder einen Rückfall gibt. Weil die Kultur kann sich jederzeit auch wieder ändern. Und es braucht erfahrungsgemäß überall, wo es schwierig ist, halt auch Kontrollelemente. Es braucht Aufsichtsfunktionen. Und damit das möglich ist, wäre eigentlich eine Gewaltenteilung in der Kirche von Nöten, damit eben ein Korrektiv, ein Gegenüber vorhanden ist, das wir im Moment nicht haben. Wo ich sage, ich glaube die RKZ, die Landeskirchen können im Moment wie ersatzweise ein bisschen diese Rolle spielen, sowie ähnlich in Deutschland das Zentralkomitee der deutschen Katholikinnen und Katholiken diese Funktion übernimmt, auch wenn das natürlich aus dem kirchlichen Denken heraus nicht unsere Aufgabe ist. Aber die Veränderung muss letztlich auch ein Stück weit abgetrotzt werden. Also ich kenne kein monarchisches System, bei dem der Monarch einfach aus innerer reifer Überzeugung Macht abgegeben.
Sandra Leis [:Du bist im Frühling 60 Jahre alt geworden. Du arbeitest womöglich noch fünf Jahre für die RKZ. Gibt es ein Hauptziel, das du erreichen willst, bis du pensioniert bist?
Urs Brosi [:Ich hoffe schon, dass ich zusammen auch mit der im Moment für uns sehr günstigen Zusammensetzung der Bischofskonferenz einige wesentliche Schritte da vorwärtskomme. Also das heißt, dass wir in fünf Jahren nicht nur die Maßnahmen, die wir jetzt einmal vor zwei Jahren angekündigt haben, umgesetzt haben, sondern auch Kontrollmechanismen etabliert haben und eine Verankerung im System haben, die etwas längerfristig funktioniert. Das andere, wo ich im Moment, ich sage mal insgesamt, trotz aller Anspannungen positiv gestimmt bin, dass die Landeskirchen, die Mitglieder der RKZ sind, überzeugt bleiben, sich solidarisch für eine gemeinsame Lösung auf nationaler Ebene einzusetzen. Man muss sich ja bewusst sein, dass das Thema des Missbrauchs schon seit über 20 Jahren in der Schweiz kirchlich auf der Traktandenliste steht. Seit 2002 gibt es Richtlinien der Bischofskonferenz, aber die nationale Ebene ist wirklich erst in den paar letzten Jahren richtig in die Gänge gekommen. Und da bin ich froh, wenn wir da dabei bleiben und stabil bleiben.
Sandra Leis [:Urs Brosi, vielen Dank für dieses Gespräch.
Urs Brosi [:Sehr gern.
Sandra Leis [:Das ist die 54. Folge des Podcasts «Laut + Leis». Zu Gast war Urs Brosi, er ist Generalsekretär der Römisch-Katholischen Zentralkonferenz. Über Feedback freuen wir uns: Schreibt gerne per Mail an podcast@kath.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83. Und: Abonniert den Podcast und bewertet ihn positiv, wenn er euch gefällt. In der nächsten Folge von «Laut + Leis» besuche ich Martin Föhn in Basel. Der umtriebige Jesuit hat 5 Jahre lang in der Spezialseelsorge den Bereich Spiritualität & Bildung mit Inhalt und Leben gefüllt und mit seiner Persönlichkeit geprägt. Nun verlässt er Basel, um in den USA die letzte Ausbildungsstufe der Jesuiten zu absolvieren. Wir sprechen über seinen Werdegang, seine Zeit in Basel und seine Zukunftspläne und fragen, weshalb die Kirche oft davor zurückschreckt, Neues auszuprobieren.
Bis in zwei Wochen – und bleibt laut und manchmal auch leise.