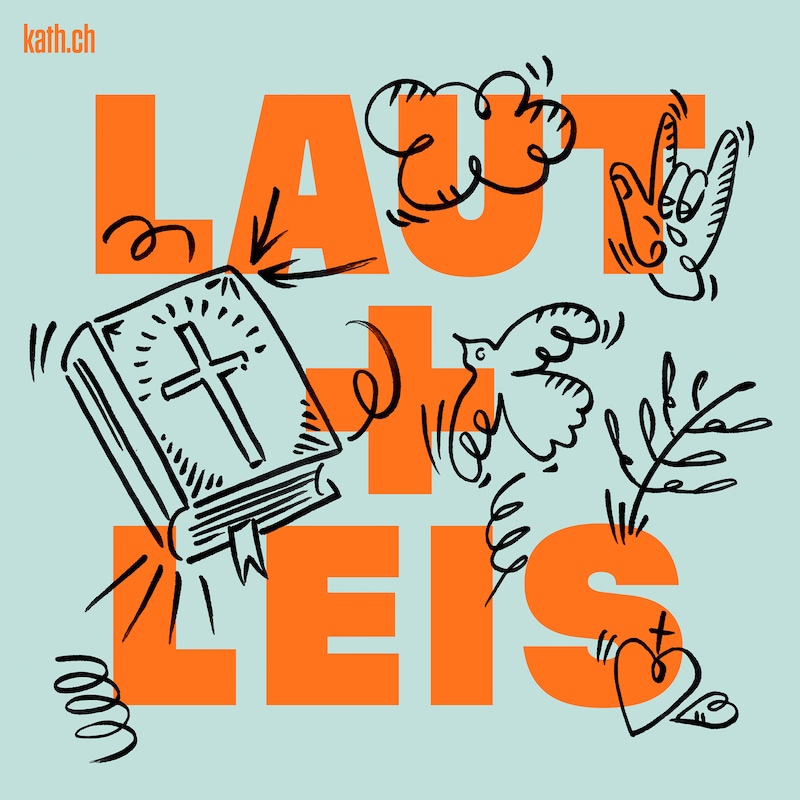
Shownotes
Seit dem Terroranschlag der Hamas auf Israel nehmen antisemitisch motivierte Gewalttaten sprunghaft zu. Auch in der Schweiz. Der Extremismusforscher Dirk Baier und der Islamwissenschaftler Reinhard Schulze gehen den Ursachen auf den Grund und sagen, was die Schweiz im Unterschied zu Deutschland und Frankreich besser macht.
Themen dieser Folge:
- Es gibt in der Schweiz zahlenmässig nicht mehr Antisemit:innen. Deutlich gestiegen ist die Bereitschaft, Antisemitismus zu äussern und bis zur Tat zu gehen
- Wie und wo sich Jugendliche radikalisieren
- Muslimische Jugendliche haben ein deutlich höheres Antisemitismus-Risiko
- Die Wahrscheinlichkeit, dass Muslime in der Schweiz schwere Gewalt ausüben, ist «gerundet null»
- Muslim:innen sind in der Schweiz deutlich besser integriert als in Deutschland und Frankreich
- Antisemitismus an Universitäten
- Drei Faktoren für die Prävention
- Die Rolle der Moscheen, der muslimischen Vereine und des Staates
- Die neuste Studie: «Antisemitismus unter Jugendlichen in Deutschland und der Schweiz. Welche Rolle spielt die Religionszugehörigkeit?»
Transcripts
Wir haben festgestellt, dass bei christlichen Jugendlichen 6 % Zustimmung festzustellen ist, bei muslimischen Jugendlichen 18 %. Das heißt, es gibt einen deutlich erhöhten Antisemitismus. Mir ist aber auch wichtig in dem Zusammenhang zu sagen: Mit Blick auf Muslime bedeutet das beispielsweise, über 80 % sind nicht antisemitisch. Das wird dann immer gleich generalisiert und gesagt, ja, alle Muslime. Nein, das machen wir nicht. Wir sagen, das Risiko ist dreimal höher. Und das müssen wir stärker fokussieren, weil diese Höherbelastung können wir beispielsweise nicht allein mit Bildung erklären.
Reinhard Schulze [:Ziel müsste es sein, dem Antisemitismus den religiösen Stecker zu entziehen und ihm sozusagen das religiöse Argument zu entziehen, in dem auch deutlich gemacht wird, dass das religiöse Argument dem Antisemitismus gegenüber eigentlich der Religiosität selbst widerspricht. Zu erkennen, dass die religiöse Geschichte des Antisemitismus eine Fehlleistung war der Religion, und dass sie sich heute endlich im 21. Jahrhundert davon befreien kann. Das heißt, hier muss die Gesellschaft, muss auch der Staat helfen, dass die muslimischen Gemeinden über die Ressourcen einer religiösen Bildung verfügen, die genau diesen antisemitischen Gebrauch der Religion abzuwehren in der Lage ist.
Sandra Leis [:Anfang März hat in Zürich ein 15-Jähriger einen orthodoxen Juden niedergestochen und lebensgefährlich verletzt. Dieser Terrorakt hat die Schweiz aufgewühlt und international für Schlagzeilen gesorgt. In dieser Podcastfolge «Laut und Leis» sprechen wir über den zunehmenden Antisemitismus in der Schweiz und fragen, welche Rolle dabei der Islam und das Christentum spielen. Ich bin Sandra Leis, und das sind meine Gäste. Dirk Baier: Er ist Kriminologe an der Universität Zürich und leitet das Institut für Delinquenz und Kriminalprävention an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Und Reinhard Schulze: Er ist Islamwissenschaftler und hat das Institut für Studien zum Nahen Osten und zu muslimischen Gesellschaften an der Universität Bern aufgebaut und während drei Jahrzehnten geprägt. Wir drei treffen uns im Toni-Areal in Zürich. Willkommen, Herr Bayer und Herr Schulze zu unserem Gespräch.
Reinhard Schulze [:Vielen Dank!
Dirk Baier [:Hallo Frau Leis.
Sandra Leis [:Die Schweizer Sicherheitsbehörden haben den Anschlag vom 2. März als Wendepunkt taxiert. Sehen Sie das auch so? Dirk Baier.
Dirk Baier [:Es ist in jedem Fall eine bis dahin in meiner Erinnerung vorkommende Tat gewesen. Für die Schweiz, von der man der Meinung ist, dass es eines der sichersten Länder der Welt ist, auch für Jüdinnen und Juden. Von daher ist es schon eine Zäsur.
Sandra Leis [:Ist es für Sie auch ein Wendepunkt?
Reinhard Schulze [:Es ist ein Wendepunkt für die Öffentlichkeit, weil die Öffentlichkeit jetzt mit dieser Tat konfrontiert wurde und vielleicht auch schockiert war darüber, das das möglich ist. Aber vom Hintergrund her war es sicherlich keine Wende.
Sandra Leis [:Warum nicht?
Reinhard Schulze [:Weil sicherlich im Hintergrund die Prozesse, die sich in der Tat geäussert haben, auch in anderen Kontexten schon bekannt waren, das heißt also bestimmte Jugendliche in Richtung antisemitischer Lebenseinstellung sozialisiert wurden und sich auch Peergroups gebildet haben mit dieser antisemitischen Grundhaltung. Von daher war das im Milieu schon da, aber eben noch nicht öffentlich.
Sandra Leis [:Es gab ja auch ein Bekennervideo, das nach der Tat bekannt wurde. Und da bekennt sich eben dieser Täter zum Islamischen Staat. Der schwört da Treue. Und er sagt auch in diesem Video, dass es sein Ziel sei, möglichst viele Juden und Jüdinnen zu töten. Wie kann es sein, dass ein 15-Jähriger, fast noch ein Kind, sich so weit radikalisiert?
Dirk Baier [:Einerseits sind das ja die Narrative, die auch schon seit vielen Jahren in den sozialen Medien kursieren und teilweise so übernommen werden. Das ist nicht unbedingt höchst reflektiert, was er da von sich gibt, sondern er reproduziert Dinge, die er überall hört. Aber dann, dass sich so ein junger Mensch in so eine Richtung entwickelt, das hat immer mit mehreren Faktoren zu tun. Jemand, der so ein bisschen an seiner Bedeutungslosigkeit arbeitet, also ein junger Mensch, der nicht genau weiß, wohin er gehört, der auch nicht wirklich gut akzeptiert ist, das spielt immer eine große Rolle. Und es spielen dann eben Gruppierungen eine Rolle, zu denen er irgendwie Zugang findet. Es müssen keine realen Gruppierungen sein, das können Online-Gruppierungen sein. Aber wenn solche Dinge zusammenkommen, dann ermöglichen sie so eine Entwicklung. Das ist alles nicht hinreichend an Faktoren, aber das macht es ein bisschen deutlich, was passieren muss, dass ein Mensch in diese Richtung geht.
Sandra Leis [:Also gerade dieser junge Täter war ja nicht sehr isoliert, wie man lesen konnte in der Berichterstattung. Er war auch vier Jahre noch in Tunesien und kam zurück und ist vor allem eben auch im Internet in den Internetforen sehr aktiv gewesen. Ist das der Schlüsselmoment, Herr Schulze?
Reinhard Schulze [:Also diese Ersatzöffentlichkeit, diese Halböffentlichkeit, die sich im Internet anbietet, die spielt natürlich eine ganz große Rolle, weil sie das Gefühl einer Selbstermächtigung ermöglicht. Also der junge Mann mag geglaubt haben, dass er seine Bedeutungslosigkeit durch seine Präsenz im Internet aufheben und auflösen kann. Und was Herr Baier gerade gesagt hat, die Bedeutungslosigkeit oder die Erfahrung von Bedeutungslosigkeit scheint sozialpsychologisch gesehen eine der ausschlaggebenden Gründe zu sein, wie ein Mensch in seinen prekären biografischen Verhältnissen ist, sich seine Welt und sein Weltbild zurechtlegt. Und dazu gehört natürlich die Erfahrung von Bedeutungslosigkeit, die ihn dann radikalisiert, um wieder Bedeutung zu erlangen. Und das, dafür ist das Internet natürlich ein wunderbares Forum. Er braucht keine reale Peergroup mehr, sondern er hat eine virtuelle Peergroup, kann sich auf diese beziehen, kann glauben, dass er von ihnen Bestätigung erfährt und kann damit sozusagen seinen Grundstimmung und seine Grundmuster in seinem Leben dann positiv für sich selbst auslegen.
Sandra Leis [:Weder die Polizei noch die Jugendanwaltschaft haben den jungen Mann auf dem Radar gehabt. Wie ist denn das möglich? Er hat ja Bekennervideos und alles Mögliche gepostet vorher.
Dirk Baier [:Ich bin immer zurückhaltend, Polizei, Nachrichtendiensten hier Vorwürfe zu machen.
Sandra Leis [:Es geht nicht um Vorwürfe. Es geht mir ums Staunen darüber.
Dirk Baier [:Ja, da schwingt schon ein Stück weit ein Vorwurf mit. Warum haben die die nicht auf dem Schirm? Die Frage ist, ob die Polizei 100’000 Menschen auf dem Schirm haben kann in der Schweiz, ob wir überhaupt wollen, dass die Polizei alle irgendwie auf dem Schirm hat, weil ein gewisses Maß an Freiheit wollen wir in unserer Gesellschaft. Von daher: Ich bin eher ein bisschen enttäuscht darüber, wenn man im Nachgang hört, wie er in seinem sozialen Umfeld ja schon auffällig war, wie Gleichaltrige gesehen haben, dass da ein junger Mensch auf dem falschen Weg ist, der wenig Freunde hat, sich zurückzieht, wie man hört, dass er auch eine Moschee besucht hat, dass die am Ende wahrscheinlich froh waren, dass er nicht wieder gekommen ist. Also dass das soziale Umfeld nicht reagiert hat und ihn sozusagen damit noch ein Stück weiter in dieses Loch reingestoßen hat.
Sandra Leis [:Das wissen wir ja nicht. Und ich meine, es könnte auch sein, dass die Eltern – sie hat er ja auch angeklagt und gesagt, sie seien zu wenig gläubig. Und auch den Onkel hat der angeklagt. Also das wissen wir ja nicht, ob die Eltern allenfalls was versucht haben. Es ist ja manchmal auch schwierig mit solchen Einzelgängen, an die ranzukommen.
Dirk Baier [:Sehr schwierig von außen zu urteilen. Mit den unvollständigen Informationen, die wir haben, sollten wir uns nicht ein Urteil bilden. Aber es sollte auch nicht zu schnell gesagt, Politik hat versagt oder Polizei hat versagt, sondern es ist in der Regel sehr viel komplizierter.
Sandra Leis [:Gehen wir mal einen Schritt zurück und schauen uns andere Fälle an bzw. schauen wir zurück auf den 7. Oktober. Da hat die Hamas Israel angegriffen. Ein Terrorangriff. Und seither ist Antisemitismus ja sprunghaft gestiegen. Ich habe hier eine Zahl: Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund, der hat eine Meldestelle, und da sind in den ersten drei Wochen nach dem Anschlag viermal so viele Vorfälle gemeldet worden wie sonst in der gleichen Zeit. Hat Sie das überrascht? Dieses vier Mal so viel?
Dirk Baier [:Also prinzipiell hat dieser Sprung alle überrascht, aber am Ende ist er gut erklärbar. Und vielleicht bin ich jetzt ein bisschen zu wissenschaftlich. Aber für mich ist das nicht gleichbedeutend damit, dass Antisemitismus sprunghaft gestiegen ist, sondern ich habe eher den Eindruck, es ist die Bereitschaft von Antisemiten gestiegen, ihren Antisemitismus zu äußern und auch bis zum Äußersten zu gehen.
Sandra Leis [:Also zu Messer zu greifen.
Dirk Baier [:Zur Tat zu gehen. Was wir wissen aus Studien: Etwa 10 % der Schweizer Bevölkerung hat antisemitische Stereotype. Ich gehe nicht davon aus, dass das mehr geworden sind seit dem 7. Oktober. Aber die 10 %, die gehen jetzt zur Tat über, die getrauen sich mehr, die artikulieren ihren Hass ungefilterter im Netz. Das ist ein Problem. Ich will das nicht kleinreden, aber diese Zahlen deuten nicht darauf hin, dass die Schweiz jetzt durchweg antisemitischer geworden ist. Ich glaube, das ist eine wichtige Nachricht, weil es gibt auch die Gegenbewegung. Es gibt sehr viele Personen, die Sympathien für Israel, für die Jüdinnen und Juden äußern. Die Polizei hat ihr Sicherheitsdispositiv hochgefahren. Also auch diese guten Phänomene sollten wir nicht vernachlässigen, wenn wir diese schrecklichen Zahlen hören, die wir da haben.
Sandra Leis [:Antisemitismus gibt es in allen gesellschaftlichen Schichten und in allen politischen Lagern. Wie unterscheidet sich denn der christliche vom muslimischen Antisemitismus?
Reinhard Schulze [:Gibt es den christlichen Antisemitismus? Gibt es den muslimischen Antisemitismus? Das ist die Frage. Ich glaube, in beiden Fällen handelt es sich um Antisemitismus, der in der Geschichte unendlich verschiedene Gestalten und Formen angenommen hat. Wir haben eine Geschichte des Antisemitismus, die sich massiv mit der christlichen Tradition verbündet hat, und das geht ja bis ins vierte Jahrhundert christlicher Zeitrechnung zurück. Also eine lange Geschichte, die damit verbunden ist, die sich immer wieder stark verändert hat und wo bestimmte Elemente sich bis heute sozusagen akkumuliert haben, dass sie den Antisemitismus von heute weiter mitprägen. Dazu gehören bestimmte Formen der Verschwörungstheorien, dazu gehören auch religiöse Vorurteile und Mythen, die sich etwa um Blutopfer und ähnliche Dinge ranken, die dann den jüdischen Gemeinden zugewiesen wurden. Kindstötungen und Hostienschändungen und all diese Dinge. Das sind aber sozusagen die religiösen Motive. Die gibt es in der islamischen Tradition nicht, weil ihnen diese Geschichte fehlt, sondern die islamische Tradition hat eine eigene Geschichte ihrer speziellen Judenfeindlichkeit. Und die sieht doch vollkommen anders aus als die christliche Geschichte.
Sandra Leis [:Das meine ich.
Reinhard Schulze [:Die Andersartigkeit ist vor allen Dingen dadurch bestimmt, dass erstens die Verfolgung der jüdischen Minderheiten in der arabischen Welt eher in wirklich prekären sozialen Situationen entstand und sich nicht als ein Grundmuster auch politischer Ordnung durchsetzte. Das zweite ist, dass diese ganzen religiösen Motive der Judenfeindlichkeit in der islamischen Tradition keine Rolle spielen. Also Juden sind nicht Feinde Gottes, so wie es in der christlichen Tradition diskutiert wurde, sondern sind Feinde der muslimischen Gemeinde. Das heißt, die Feindschaft war auf die Lebenswirklichkeit der Menschen bezogen und war deshalb auch immer wieder verknüpft mit einer Situation wie in Marokko, Tunesien, Algerien, wo Nachbarschaften über Jahrhunderte existierten, die sich gar nicht religiös unterschieden, sondern ihre religiösen Praxen einfach anerkannten. Das hat sich aber eben doch mit der Zeit immer wieder verändert. Und das Entscheidende ist eben das Ende des 19. Jahrhunderts über die christliche Mission, aber auch über die christlichen Gemeinden in der Levante und in Nordafrika. Der christliche, europäische, fast schon säkularisierter Antisemitismus fasste in der arabischen Welt Fuß. Die muslimischen Autoren der Zeit schauten erst mal erstaunt und sagten: Was ist denn das? Was kommt denn da auf uns zu? Das ist nicht Teil unserer Tradition. Und das wurde eben erst später islamisiert und in den eigenen Kanon eingeschrieben.
Sandra Leis [:Wenn man es historisch anschaut, kann ich Ihnen durchaus folgen. Aber Sie selber haben auch in Interviews schon gesagt, dass Antisemitismus in der nahöstlichen Welt dreimal so weit verbreitet ist wie im europäischen Durchschnitt. Wie ist es dazu gekommen?
Reinhard Schulze [:Ja, ja, das ist richtig und auch heute die empirische Beobachtung, die wir haben. Übrigens muss man schon sagen, dass die Menschen, die aus nahöstlichen Ländern in die Schweiz kommen, einen erheblich niedrigeren Anteil von Antisemitismus aufweisen als die Menschen, die in nahöstlichen Ländern aktuell leben. Das heißt, die Differenz ist schon ziemlich groß. Der nahöstliche Antisemitismus hat eben den in Anführungsstrichen «Vorteil», dass er ohne Juden ist. Denn im Nahen Osten gibt es außer in Israel praktisch keine jüdischen Gemeinden mehr. Das heißt, die Menschen haben gar kein soziales Korrektiv. Sie können gar nicht schauen, was denn wirklich ein Jude oder eine Jüdin ist, weil sie mit ihnen gar nicht leben. Das heißt, Antisemitismus ist im Nahen Osten sozusagen so allgemein verfügbar, dass er gar nicht mehr als negativ erachtet wird.
Sandra Leis [:Er gehört einfach dazu.
Reinhard Schulze [:Antisemitismus gehört sozusagen zum Nationalismus der einzelnen Nationalstaaten. Und da der Antisemitismus seine grundsätzliche Heimat immer im Nationalismus findet, ist denn die nationalistische Kultur in der arabischen Welt wahrscheinlich der Rahmen gewesen, in dem sich dieser Antisemitismus mit all den ganzen Karikaturen und all dem, was dazu gehört, eingenistet hat. Und in dem Moment, wo die Lebenswirklichkeit sich ändert und Menschen etwa aus Syrien oder aus Jordanien oder wo auch immer hierher kommen, erleben sie eine andere soziale Situation. Sie erleben jüdische Wirklichkeiten ganz anders. Und offensichtlich nimmt dann der Antisemitismus ab. Das heißt, Begegnung ist ein ganz wesentliches Element dafür, eine solche antisemitische Vorstellungswelt abzubauen.
Sandra Leis [:Über Prävention reden wir später noch. Jetzt kehren wir zurück zur Schweiz. Sie, Herr Beier, haben die neuste Studie gemacht. Das war 2021. Etwas Neueres gibt es nicht. Sie haben in der Schweiz verschiedene Schulen angeschaut und geprüft, wie christliche Jugendliche und muslimische Jugendliche, wo da antisemitische Ressentiments vorhanden sind. Fassen Sie doch Ihre Ergebnisse mal kurz zusammen. Was sind Ihre Erkenntnisse?
Dirk Baier [:Ja, wir haben eigentlich eine Studie zum Thema Extremismus unter jungen Menschen gemacht. Wir reden über 17-, 18-jährige junge Menschen und haben Rechtsextremismus, Islamismus, Linksextremismus untersucht. Aber da einzelne ideologische Elemente in den Extremismen auch Antisemitismus sind, haben wir uns auch der Erfassung von Antisemitismus gewidmet. Das heißt, wir haben Aussagen im Fragebogen drin gehabt, wie beispielsweise «Die Juden sind an ihrer mit Verfolgung mitschuldig» oder «Sie haben zuviel Einfluss in der Schweiz». Und dann fragt man Menschen, wie sie dem zustimmen. Wir haben festgestellt, dass bei christlichen Jugendlichen etwa 6 % Zustimmung festzustellen ist, bei muslimischen Jugendlichen 18 %. Und wir haben dieselben Studie in Deutschland durchgeführt mit identischen Ergebnissen. Das heißt, es gibt einen deutlich erhöhten Antisemitismus. Mir ist aber auch wichtig in dem Zusammenhang zu sagen, mit Blick auf Muslime bedeutet das beispielsweise: Über 80 % sind nicht antisemitisch. Also das wird dann immer gleich generalisiert und gesagt, ja, alle Muslime. Nein, das sagen wir nicht. Wir sagen, das Risiko ist dreimal höher, und das müssen wir stärker fokussieren. Weil diese höhere Belastung können wir beispielsweise nicht allein mit Bildung erklären, wenn wir die Bildungsgänge vergleichen, beispielsweise Abiturienten. In einer christlichen und muslimischen Zugehörigkeit finden wir den Unterschied genau noch so. Es ist also nicht nur ein reines Bildungsphänomen, da ist mehr dahinter.
Sandra Leis [:Aber es ist auch ein Bildungsphänomen.
Dirk Baier [:Ja, Vorurteile sind immer ein Bildungsphänomen. Da können wir uns Ausländerfeindlichkeit, wir können uns Feindlichkeit gegenüber schwulen und lesbischen Personen angucken. Egal, es gibt immer einen Zusammenhang zum Bildungsgrad. Das heißt, höhere Bildung geht mit geringeren Vorurteilen einher, weil wir komplexer denken. Und das schützt. Aber das macht nicht unmöglich, Vorurteile zu haben. Denn wir sehen in in manchen Bildungsgruppen und Hochschulen durchaus zurzeit wieder Antisemitismus. Aber es ist generell ein Schutzfaktor. Das muss man sagen wie auch Kontakt ein starker Schutzfaktor ist. Aber auch nicht jede Form von Kontakt, also der muss unter einigermassen Gleichen sein, muss moderiert sein. Man muss wirklich Gelegenheit haben, den anderen kennenzulernen. Also ein Fußballspiel zwischen einem jüdischen Team und einem muslimischen Team reicht nicht aus, um Vorurteile zu senken, sondern da muss man anders den Kontakt gestalten. Aber Kontaktbildung sind wichtige Wege. Doch sie garantieren auch nicht Vorurteilsfreiheit.
Sandra Leis [:Wenn so ein Anschlag passiert oder auch sonst etwas passiert, was, was ein Muslim anstellt beispielsweise, dann kommt sehr schnell, gerade aus dem linken politischen Lager der berühmte Satz, dass quasi der Anteil von gewaltbereiten muslimischen Personen in der Schweiz, dass der sich im Promillebereich bewegt. Ist das richtig?
Dirk Baier [:Ich scheue mich, hier irgendwelche Zahlen anzugeben. Wenn man mich fragen würde, würde ich prinzipiell sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass Muslime schwere Gewalt ausüben in der Schweiz, ist gerundet null. Also wir haben fast kein Risiko, aber eine einzelne Person, die sich in einer schwierigen Situation anscheinend befindet, kann ausreichen, um tödliche Anschläge zu begehen. Und das ist das Restrisiko, was wir nie in einer freiheitlichen Gesellschaft wegkriegen. Oder wir kriegen es nur weg, wenn wir zu Zugeständnissen bereit sind, die dazu führen, dass wir keine freiheitliche Gesellschaft mehr sind. Von daher: Es ist sehr, sehr gering, das Risiko. Aber es gibt natürlich auch ein gewisses Risiko, dass vielleicht ein Christ aus irgendwelchen Gründen zur Waffe greift und einen Amoklauf verübt. Das ist alles im Bereich des Möglichen.
Sandra Leis [:Das heisst, man spricht in der Schweiz immer noch von Einzelfällen. Und deshalb ist es eigentlich auch verständlich, dass Muslime und Musliminnen sich wehren gegen diesen Generalverdacht, der dann sehr schnell hochkommt.
Dirk Baier [:Es ist verständlich. Wir haben wenige Fälle. Und trotzdem, wir müssen ja nicht nur in die Schweiz gucken, wir haben auch ein paar Angriffe in Deutschland gehabt auf Jüdinnen und Juden. Wenn wir dann nach der Täterschaft gucken, sehen wir hauptsächlich muslimische Personen oder sich zum Islam bekennende Menschen, die diese Taten ausführen. Also das muss man gleichzeitig mit sagen.
Sandra Leis [:Ja, wir wollen hier Tacheles reden, das ist ganz wichtig. Sie, Herr Schulze, haben auch mehrfach schon gesagt, dass in der Schweiz Muslime viel besser integriert seien als beispielsweise in Frankreich oder in Deutschland. Woran machen Sie das fest?
Reinhard Schulze [:Ja, vor allen Dingen fällt das auf bei den Bezugspunkten der Menschen, die hierherkommen. Wenn sie gefragt werden: Ja, wo fühlst du dich wohl? Dann ist das Wohlbefinden oft bezogen auf die Gemeinde oder auf den Raum der Gemeinde, manchmal auf den Kanton sogar. Der lokale Raum spielt dabei eine ganz große Rolle. Und dabei wird immer wieder betont, dass dieser lokale Raum eben Teil einer größeren Gemeinschaft ist von Schweizerinnen und Schweizern, die sowieso hier schon wohnen. Und dass es so eine Art von Vorteil ist, wenn man mit ihnen viel Kontakt hat, wenn man mit ihnen irgendwie in Berührung ist. Das heisst, im Selbstverständnis von Menschen, die hierherkommen, ist das Angebot sehr viel größer, sich positiv mit dem Raum, mit dem sozialen Raum zu identifizieren, in dem sie ankommen. Und das hat etwas wahrscheinlich mit der schweizerischen Kultur zu tun, mit der sozialen Kultur, die sich über die Jahrzehnte entwickelt hat, wo Abwanderung, Auswanderung alltäglich gewesen sind. Und da hat sich so eine Art von Kultur entwickelt, die auch mit dem extremen Lokalismus des Landes zu tun haben, also wo die Gemeinde wirklich noch das entscheidende soziale Handlungsfeld darstellt, bis hin zum Verein oder Tennisverein, was weiss ich. Und das ermöglicht eine einfachere Integration als in den großen Metropolen, etwa in Köln oder Berlin oder Paris oder Brüssel, wo Biografien faktisch gar nicht mehr mit den sozialen Welten in Kontakt kommen, in denen die Menschen leben, also mit den größeren Welten in Kontakt kommen und sehr viel stärker solche isolierten Verhältnisse entstehen, die sich in den Armenvierteln, in den Banlieues auch entfalten können. Das haben wir ja alles nicht. Selbst Zürich ist eine große Stadt. Aber es ist überhaupt nicht vergleichbar mit Verhältnissen, wie wir sie in Wien oder in London oder Paris haben.
Sandra Leis [:Ich möchte nochmals nach Zürich blicken. Wie der Antisemitismus-Bericht, der kürzlich erschienen ist, gezeigt hat, passieren antisemitische Vorfälle jetzt vermehrt in den Schulen. Und da lese ich Ihnen gerne kurz was vor, was die «Neue Zürcher Zeitung» im März geschrieben hat über eine Zürcher Schule. «Ein aus Ägypten stammender 7-Jähriger zeigt in einer Zürcher Schule den Hitlergruß und erklärt, Juden müssten sterben. Zwei 9-jährige Mädchen, die sich für die Fasnacht geschminkt haben, bekommen an derselben Schule zu hören, dass Schminken «haram» sei, nicht erlaubt nach islamischen Glaubensvorschriften. Und ein Lehrer wird von Haram-Rufen unterbrochen, als er ein Weihnachtslied anstimmt.» Also so etwas gibts eben nicht nur in Köln oder in Berlin oder in Paris, sondern offenbar auch hier in Zürich. Was sagen Sie dazu?
Dirk Baier [:Das gibt es. Es ist prinzipiell wichtig, dass wir darüber sprechen. Wichtig, dazu zu sagen: Wir reden über Einzelfälle. Die beschreiben nicht die Situation in der Schule generell. Und wir müssen natürlich hier, wenn so junge Kinder schon.
Sandra Leis [:Der Knabe hier ist sieben.
Dirk Baier [:Wenn so junge Kinder schon in dieser Form in Erscheinung treten, dann ist im Elternhaus das Problem vorhanden. Und das deutet darauf hin, dass wir es nicht schaffen, in bestimmte wenige Familien die Idee des toleranten Miteinander-Zusammenlebens zu bringen. Wir haben ein Problem, dass wir manche Eltern nicht erreichen, die auch nicht zu Elternabenden kommen. Das wissen die Lehrkräfte. Da wird keine Kommunikation von der Schule aus gelesen. Die Schulsozialarbeiter kommen an die Schulen. Hier müssen wir neue Wege gehen. Oder es gibt einen Verein in der Schweiz, NCBI: Die bilden Brückenbauer aus. Das heißt, es braucht Personen aus dieser Community. Hier braucht es Muslime, die aber gut in der Schweizer Gesellschaft verankert sind und die versuchen, die Brücke zu schlagen zu Milieus, die scheinbar abgekoppelt haben, sich zurückgezogen haben. Und das sind Präventionsansätze, die hier notwendig sind. Es deutet darauf hin, dass wir uns neu orientieren müssen. Es ist aber kein Untergang der Schweiz. Es ist kein Untergang der Schule. Was da drin steckt, das wird dann immer gern so aufgebauscht als Problem. Das heißt, wir müssen ein bisschen neu denken. Wir kommen scheinbar mit den bisherigen Methoden nicht an das Ziel. Und das sollten wir ernst nehmen. Und ich finde, es wird darauf reagiert. Die Schweiz ist aus meiner Sicht immer vorbildhaft, Dinge frühzeitig zu erkennen und dann auch frühzeitig lokal zu reagieren. Das Lokale ist wichtig.
Sandra Leis [:Wie das auch Herr Schulze sagt.
Dirk Baier [:Da hat die Schweiz einfach super Möglichkeiten. Sie ist kleiner und überschaubarer. Und meine Erfahrung, die ist noch nicht so lang hier in der Schweiz. Aber meine Erfahrung hat gezeigt, die Schweiz kriegt Dinge schnell in den Griff. Beispielsweise Jugendkriminalität: Darüber haben wir vor fünf Jahren diskutiert. Jetzt sind die Zahlen am Sinken, weil die Städte beispielsweise reagiert haben. Also hat die Schweiz auch Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Und das macht die Schweiz normalerweise gut. Das sollte man ein bisschen Vertrauen haben auch in die Schulen, auch in die soziale Arbeit, auch in die Politik, dass da gehandelt wird.
Sandra Leis [:Kommen wir noch mal auf die Bildung. Wir haben vorhin gehört, dass Bildung ein wichtiger Faktor ist, dass man nicht antisemitisch reagiert, dass man differenzierter denkt. Das ist eine Möglichkeit. Allerdings wenn ich an die Bildung denke und an die Universitäten: Sie haben es vorhin schon kurz angedeutet, in den USA haben Elite-Universitäten ganz grosse Probleme mit Antisemitismus. Es gibt sie auch in der Schweiz. Es gab Probleme in Basel und vor allem auch in Bern. Herr Schulze, Ihr eigenes Institut, das Sie 30 Jahre lang zuerst aufgebaut und dann geprägt haben, wurde geschlossen wegen, ich zitiere, «unhaltbarer Zustände», also das ist nach Ihre Emeritierung passiert – erst kürzlich. Wie kann das sein? Da ist ja Bildung vorhanden. Und trotzdem gibt es offenbar eine Form von Verblendung, dass man das Institut in Bern schließen musste.
Reinhard Schulze [:Bildung ist ja an sich kein Garant für vernünftige Anschauungen oder auch diskussionswürdige Haltungen oder Meinungen. Bildung ist einfach eine Ressource, die man für die eigene Meinungsbildung zur Verfügung hat. Und in bestimmten Situationen, in bestimmten Umständen sind die Einstellung und die Vorstellung mit den Menschen auch an Universitäten, mit dem sie auch Forschungen betreiben, gar nicht von der Bildung abhängig, sondern von ganz anderen Faktoren bestimmt. Das heißt, es gibt noch einen zweiten Bildungsraum, der nicht der offizielle staatliche Bildungsraum ist, sondern eine Art von sozialer, kultureller Bildungsraum, in dem sich die eigentlichen Urteile formieren und herausbilden, mit denen dann Menschen an die Universitäten auch kommen und dort dann nach bestimmten Mustern dann die Wirklichkeit klassifizieren. Was wir auch hier erleben, Was aber in Amerika noch viel stärker ist, ist die Beurteilung dann der Gegenwart: Wem gehören die Privilegien? Wer ist privilegiert, eine Rede zu führen? Wer ist privilegiert, über jemanden anderen zu reden? Wer hat sozusagen die Macht in den Auseinandersetzungen über die richtigen Urteile der Welt oder was weiß ich, was damit zusammengewürfelt wird. Und das führt dann dazu, dass viele Studierende in den USA, aber auch einige hier bei uns in der Schweiz jetzt mit einem bestimmten Vorurteil im wahrsten Sinne des Wortes an die Bildungsinhalte herangehen und diese Bildungsideale vermeintlich kritisieren, mit ihrem Vorurteil kritisieren und dadurch auch sich einen Vorteil wiederum gegenüber anderen einhandeln. Und das ist eine Situation, die auch an den Universitäten im Augenblick manchmal zu Schwierigkeiten führt und dann auch zu solchen Auseinandersetzungen führt, wie wir sie in Basel und in Bern erlebt haben.
Dirk Baier [:Auch hier muss man natürlich sagen: Diese kritische Haltung, die an den Universitäten gegenüber bestimmten etablierten Narrativen geübt wird, die hat uns in den letzten Jahrzehnten auch vorangebracht. Die hat uns in eine Gesellschaft gebracht, die sehr reflektiert ist, was Vorurteile angeht, was Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten angeht. Also man muss sagen, die Grundhaltung, die auch an Universitäten herrscht, die der Kritik an etablierten Verhältnissen und Narrativen übt. Die ist grundsätzlich wichtig und ist eigentlich ein Entwicklungstreiber. Und jetzt kommen wir teilweise auch in Situationen, wo sie Weiterentwicklung hemmen könnte. Und eigentlich die Lösung müsste sein, sachliche, sinnvolle Diskussionen Raum schaffen, der ist an Universitäten vorhanden. Dieser Raum. Und zurzeit gelingt es uns nicht, das in konstruktive Diskussionsgefäße zu gießen. In den USA sehr viel stärker als das jetzt hier im deutschsprachigen Raum der Fall ist. Aber eigentlich sind die Universitäten nicht nur Ort des Problems. Sie sind auch Ort der Lösung des Problems und ich rechne damit, dass die richtige Richtung hier wieder gefunden wird. Wir sind gerade an der Suche, und man sollte jetzt auch hier das Kind nicht mit dem Bade ausschütten und sagen, an den an den Universitäten, da sind zu viele irgendwie jetzt linksextrem oder wie auch immer denkende Menschen. Deswegen müsse man jetzt gucken, dass überall geschlossen wird und dieser Fachbereich zugemacht wird. Das sind nicht die guten Folgerungen daraus, sondern es braucht die Diskussion, es braucht die Reflexion, und da sind die Universitäten der Ort.
Sandra Leis [:Lassen Sie uns zum Schluss noch über Prävention sprechen. Wir haben es schon immer wieder mal angedeutet. Wichtig ist Kontakt, wie Sie es vorhin ja geschildert haben, für die Integration. Ich denke, die größte Herausforderung bei der Prävention sind die Foren im Internet. Wie will man da einen jungen Menschen begleiten? Ich meine, in der Schule heißt es, wenn man an einen Elternabend geht: Begleiten Sie Ihr Kind. Seien Sie dabei, seien Sie offen, wenn es Fragen hat. Aber es will nicht immer fragen. Kann ich also aus eigener Erfahrung sagen. So einfach ist es nicht. Was sind da Ihre Vorstellungen? Wie kann man verhindern, dass sich Jugendliche im Internet radikalisieren?
Dirk Baier [:Also ich finde die Aussage, dass neugierig sein und im Gespräch bleiben mit den Kindern, die würde ich trotzdem aufrechterhalten wollen. Und das kann man natürlich nicht mit einem 15-jährigen anfangen. Also da muss man mit seinem Kind schon bei null angefangen haben, in diesem Gespräch sein gemeinsam sich Medien zu erschließen, gemeinsam eine Sendung zu sehen, im Fernsehen mit einem Fünf- bis Sechsjährigen und darüber reden. Also so was wächst über die Zeit hinweg und das kann man nicht mit dem 15-Jährigen plötzlich anfangen.
Sandra Leis [:Klar, trotzdem gibt es Jugendliche, die sich in der Pubertät sehr zurückziehen.
Dirk Baier [:Ja, das ist Teil der Identitätsfindung. Das ist ein Bildungsprozess, junge Menschen grenzen sich ab. Also man muss einfach auch hartnäckig sein als Elternteil. Aber interessiert bleiben ist, glaube ich, ganz wichtig. Das Zweite, was wichtig ist: Die Plattformbetreiber, die haben eine Verantwortung. Und wenn ich sehe, wie in den USA Herr Musk wieder alles zulässt auf Twitter mit der irrsinnigen Annahme der Meinungsfreiheit. Nein, Hass, Hetze, Abwertung ist keine Meinung. Das verletzt Menschen. Das führt zu toxischet Diskussionskultur und am Ende eben auch zu radikalem Verhalten. Nein, die Plattformbetreiber, die haben eine Verantwortung, die müssen auch löschen. Ich weiß, das ist heikel, das muss man diskutieren. Also «20 Minuten» hier in der Schweiz beispielsweise hat ein Social Responsibility Board eingeführt, wo die solche Dinge im Team klären. Das kann niemand alleine klären, sondern es müssen zehn, 15 Köpfe darüber nachdenken. Ab wann ist die rote Linie überschritten, ab wann muss gelöscht werden? Das kann man auch nicht einfach an die Technik auslagern. Da hilft uns KI nicht, da brauchen wir menschliche Köpfe, das ist wichtig. Und das Dritte, was wichtig ist, natürlich all diese Akteure, die mit jungen Menschen arbeiten, Schulen. Ich sehe aber auch Vereine beispielsweise, da gibt es teilweise und ungehobenes Potenzial. Sie müssen dranbleiben an den jungen Menschen. Die müssen auch versuchen, den Umgang auf bestimmte negative Medieninhalte vorzubereiten. Medienkompetenz lautet hier das Stichwort. Und da müssen alle diese Sozialisationsinstanzen in den jungen Menschen sich bewegen. Die müssen da alle ein bisschen am gleichen Strick ziehen, auch religiöse Vereinigungen beispielsweise. Es braucht, um einen Menschen zu erziehen, ein ganzes Dorf. Dieses afrikanische Sprichwort hat immer noch Bestand, heute mehr denn je. Und in der Schweiz gibt es diese Dörfer, diese kleineren Städte, die die Grundlage dafür legen.
Sandra Leis [:Am Sonntag nach der Tat im März hat in Zürich die Vereinigung der Islamischen Organisationen Zürich sofort Stellung zum Vorfall bezogen und hat die Tat vehement verurteilt. Sie hat geschrieben, und das kann man heute noch auf der Website lesen: «Wir erheben unsere Stimme und machen klar, dass dies nichts mit der muslimischen Gemeinschaft in Zürich zu tun hat. Die Vereinigung und ihre Mitgliedsorganisationen halten weiterhin an den Grundsätzen des friedlichen Zusammenlebens fest und verurteilen jegliche Art von Gewalt.» Reicht das?
Reinhard Schulze [:Nein, das reicht sicherlich nicht. Das reicht zwar für die Vereine, aber das reicht nicht, um das Problem der islamischen Rahmung eines Antisemitismus zu bekämpfen. Dazu muss noch mehr kommen. Wir sprachen über Bildung als eines der wichtigsten Instrumente, um der religiösen Rahmung des Antisemitismus entgegenzuwirken. Das heißt, die Vereine sind ja nicht in dem Sinne kompetent, religiöse Bildung anzubieten, sondern dazu braucht es ein ganz neues Religionspersonal, das in den Schulen, in den Familien, in den Vereinen, in den Moscheen hauptamtlich oder nebenamtlich für religiöse Bildung zuständig ist. Und es muss ein Verständnis darüber existieren, was ist denn überhaupt religiöse Bildung? Ziel müsste es sein, dem Antisemitismus den religiösen Stecker zu entziehen und sozusagen das religiöse Argument zu entziehen, in dem auch deutlich gemacht wird, dass das religiöse Argument dem Antisemitismus gegenüber eigentlich der Religiosität selbst widerspricht. Es geht darum zu erkennen, dass die religiöse Geschichte des Antisemitismus eine Fehlleistung war der Religion und dass sie sich heute endlich im 21. Jahrhundert davon befreien kann. In der islamischen Geschichte ist diese Fehlleistung relativ kurz. Sie begann im engeren Sinne erst 1948 und hat jetzt ihren Höhepunkt erreicht. In der christlichen Geschichte ist sie uralt, und man kann sich auch genauer fragen, also seit wann der Aufarbeitungsprozess wirklich so produktiv gelungen ist. Dass heute religiöse Bildung etwa im Katholizismus oder im Protestantismus Antisemitismus-frei bedeutet, kann man noch drüber diskutieren, aber letztendlich ist die religiöse Bildung instrumentell dafür da. Nur denke ich, dass eben die Vereine selbst, die sich sehr wohltuend von so einem Terroranschlag distanzieren, nicht hinreichend vorbereitet sind, dies zu leisten. Dazu braucht es eben nach unserem heutigen modernen Standards auch Qualitätsmerkmale für Bildungsvermittlung. Das heißt, hier muss die Gesellschaft, muss auch der Staat helfen, dass die muslimischen Gemeinden über die Ressourcen einer religiösen Bildung verfügen, die diesen antisemitischen Gebrauch der Religion abzuwehren in der Lage ist. Dazu muss die Gesellschaft auch bereit sein, Kosten zu übernehmen. Dazu kann sie nicht einfach nur sagen, wir lassen einfach die muslimischen Vereine ihre Lehrer in die Schulen schicken und da mal ein bisschen parlieren über den Islam und sagen, wie das mit dem Propheten war. Das reicht nicht aus, sondern die komplexe Aufarbeitung der Geschichte, auch der antisemitischen bzw. judenfeindlichen Geschichte in der islamischen Tradition ist genauso wichtig wie die Aufarbeitung der antisemitischen Tradition, wie wir sie auch in der Schweiz erlebt haben, in den Diskussionen nach dem Zweiten Weltkrieg.
Sandra Leis [:Und welche Aufgabe haben denn die Moscheen?
Dirk Baier [:Es ist vor wenigen Wochen erst eine Studie in Deutschland erschienen, die uns auch Hinweise geben kann für die Schweiz. Diese Studie kann methodisch sehr gut nachweisen, dass Menschen, die intensiver in die Moschee gehen, antisemitischer sind. Und das hat natürlich nicht mit der Moschee an sich zu tun, sondern was da drin passiert, was da drin gepredigt wird, welche religiöse Bildung dort stattfindet. Und das ist, glaube ich, ein Hinweis darauf, dass man sehr genau gucken muss, wer erzähltwas in den Feldern, wo religiöse Bildung stattfindet. Man ja dazu übergegangen, dass die Imame beispielsweise in dem Land ausgebildet werden sollen, in dem sie predigen. Da hat Deutschland in der Vergangenheit kläglich versagt, weil die haben sich immer die Imame aus der Türkei kommen lassen, die kein Wort Deutsch gesprochen haben und natürlich nur gepredigt haben, was Erdogan wollte. Also die Imam-Ausbildung innerhalb des Landes ist der erste Schritt. Es geht um religiöse Bildung, wie die stattfindet, wer das macht, was vermittelt wird. Und da müssen wir, da muss eine andere Form von Organisiert- und Strukturiertheit stattfinden.
Reinhard Schulze [:Es ist der alte Streit: Henne oder Ei. Was war zuerst da? Und nach meiner Erfahrung und die ist jetzt nicht empirisch, sondern nur persönlich. Empirisch gesehen ist es eher so gewesen, dass in den 70er 80er Jahren Menschen, die bis dahin nicht in die Moschee gegangen sind, mit einem ganz merkwürdigen, also aus Nahost oder teilweise auch in Deutschland oder Frankreich oder in der Schweiz mit merkwürdigen antisemitischen Vorstellungswelten hingegangen sind. Die lebten von Verschwörungstheorien. Und dann findet in den 80er 90er Jahre eine Islamisierung von Teilen der Welt der sozialen Welten statt. Die Menschen gehen dann in die Moschee, nehmen ihre Kids mit in die Moschee und der Vater gewinnt an Privileg in der Moschee dadurch, dass er seinen antisemitischen Hintergrund in die Moschee quasi reinbringt und ihm plötzlich auffällt, Ja, der Prophet war schon der erste Antisemit. Der bestätigt sozusagen nur. Er fühlt sich in der Moschee dadurch bestätigt, dass das, was er sagt, da gar nicht kritisiert wird. Und diese fehlende diskursive Kritik, die in den Moscheen eigentlich notwendig wäre, um zu sagen: Also du kannst gerne bei uns mitmachen, aber deine antisemitischen Vorstellungen kannst du draußen abgeben, die gehören in deine alte Welt, die gehören nicht in die Moschee hinein. Diese Distanzierung sozusagen, diese Mechanismen, die fehlen im Augenblick in den Moscheen, sodass man den Eindruck bekommt, als würde in den Moscheen so etwas wie eine Art von antisemitischer Kultur entstehen. Das ist bei der Fluktuation, die in den Moscheen existiert, bei der Beliebigkeit, die überhaupt auch bei Moscheen, Besuchern besteht, gar nicht so festlegbar. Das kennen wir aus der Moschee in Biel, das kennen wir auch in Bern aus der Moschee.
Sandra Leis [:Oder Winterthur.
Reinhard Schulze [:Ja, auch Winterthur. Ich glaube, die Moschee ist selbst nicht der Ort des Problems, sondern es sind die Menschen, die dann mit ihren antisemitischen Vorstellungen plötzlich eine Art von religiösem Erweckungserlebnis haben. In die Moschee reingehen und sagen, ich war schon immer ein guter Muslim. Und wenn das den Antisemitismus dann noch aufwertet und trägt, dann wird es zum wirklichen Problem.
Dirk Baier [:Und gleichzeitig wird der Ort zu wenig genutzt, um das Problem zu bearbeiten.
Reinhard Schulze [:Genau. Und das ist genau das, wozu die Moscheen in die Lage versetzt werden müssen. Das bedeutet aber eine grundsätzliche Reform des Repräsentationswesens der Muslime in der Schweiz. Das heißt, die Muslime können nicht mehr allein durch die Vereine repräsentiert werden, sondern müssen durch eine Religionsgemeinschaft, die über kompetente Institutionen verfügt, abgebildet und repräsentiert werden.
Sandra Leis [:Dirk Baier. Reinhard Schulze, vielen Dank für dieses engagierte Gespräch.
Dirk Baier [:Gern.
Reinhard Schulze [:Sehr gern.
Sandra Leis [:Das war die 25. Folge des Podcasts «Laut + Leis». Zu Gast waren der Islamwissenschaftler Reinhard Schulze und der Extremismusforscher Dirk Baier. Wir haben über den zunehmenden Antisemitismus in der Schweiz gesprochen und gefragt, welche Rolle dabei das Christentum und der Islam spielen. Wenn Ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns Feedback geben möchtet, gerne per Mail an podcast@kath.ch oder per WhatsApp auf die Nummer 078 251 67 83.
In der nächsten Folge des Podcasts «Laut + Leis» geht's an die Biennale nach Venedig. Der italienische Künstler Maurizio Cattelan erhitzte die Gemüter einst mit einer Papst-Persiflage. Jetzt hat ausgerechnet der Vatikan ihn für die Biennale nach Venedig geholt und ihn beauftragt, für das Frauengefängnis eine Arbeit zu realisieren. Papst Franziskus persönlich reiste Ende April nach Venedig und ist damit der erste Papst, der die Biennale besucht hat. Was die Kunst bewirkt und ob es auch um einen cleveren Schachzug der Kirche geht, darüber spreche ich mit der Kunsthistorikerin und Cattelan-kennerin Madeleine Schuppli. Bis in zwei Wochen. Und bleibt laut und manchmal auch leise.